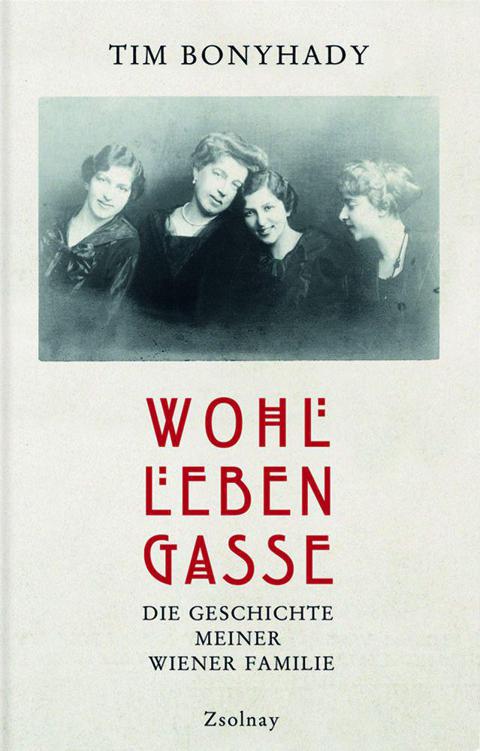![Wohllebengasse: Die Geschichte meiner Wiener Familie (German Edition)]()
Wohllebengasse: Die Geschichte meiner Wiener Familie (German Edition)
selbst zu bestimmen, wohin sie fuhr. Bei anderen Gelegenheiten drückte sie ihre Frustration über ihre Eltern aus, indem sie erklärte, wie sie ihren eigenen Haushalt führen und ihre eigenen Kinder erziehen würde. Da sie nicht an der Universität inskribieren oder einen Beruf ergreifen konnte, gab es sonst kaum etwas für sie zu tun.
Tango
AM WOHLSTEN FÜHLTE sich Gretl auf dem Tanzparkett. Bei ihrem ersten Ball, den sie 1908 als Elfjährige besuchte, hielt sie sich für die Ballkönigin, weil sie mehr Buketts erhielt als die anderen Mädchen. Ihre erste Tanzveranstaltung mit Erwachsenen 1911 war noch aufregender. Sie fand am Nachmittag des 26. Dezember, den Katholiken als Stephanstag feiern und Gretl als zweiten Weihnachtstag bezeichnete, in der Familienwohnung in der Schleifmühlgasse statt. Sie trug das rote Ballkleid, Schuhe und Handschuhe, die sie von den Eltern am Heiligen Abend geschenkt bekommen hatte. Nachdem sie bis zur Erschöpfung getanzt hatte, erklärte sie, das sei »der schönste Tag meines Lebens« gewesen, ebenso wie ihre Firmung drei Jahre zuvor; diesmal allerdings fügte sie hinzu: »es ist keine Übertreibung.«
Nach dem Ende ihrer Schulzeit 1912 ging sie viel öfter tanzen. Moriz und Hermine hatten ihr zu Weihnachten ein leuchtend blaues Ballensemble geschenkt, und so begann sie ihre erste Saison und besuchte in zwei Monaten sechs Bälle. Ihre nächste Saison im folgenden Jahr war doppelt so rege, was Moriz und Hermine dazu bewog, ihr zwei weitere Ensembles zu schenken. Nur einer der Bälle, die sie besuchte, war eine öffentliche Veranstaltung im Kursalon im Stadtpark; ein weiterer fand privat in der Tanzschule Kopetzky statt, die anderen in Wohnungen. Moriz und Hermine luden 1913 zu einem Ball in die Schleifmühlgasse, ein Jahr später in die Wohllebengasse. Alle anderen wurden von reichen Familien mit Kindern in ähnlichem Alter veranstaltet.
Wenn Gretl sich auf diese Tanzereien vorbereitete, kam eine Friseuse in die Familienwohnung; mindestens einmal arrangierte sie das Haar im modischen griechischen Stil. Gretl wurde hin und wieder nicht vom ein Jahr älteren Erni, sondern auch von den drei Jahre jüngeren Käthe und Lene begleitet. Für gewöhnlich aber ging sie mit Erni oder allein. Auf dem Weg zu und von den Bällen wurde sie immer eskortiert, manchmal von Hermine, manchmal von ihrer Tante Ida (die keine Kinder hatte), manchmal von den Eltern anderer junger Frauen, die bei den Tanzveranstaltungen dabei waren. Wenn Gretl zu Mitternacht im Bett lag, fand sie das zu früh. Meist aber hatte sie keinen Grund, sich zu beklagen, da sie oft bis in den Morgen hinein tanzte und erst um drei, fünf und einmal erst um halb sieben nach Hause kam. Bei solchen Gelegenheiten notierte sie befriedigt, wie spät sie aufgestanden sei.
Einer von zehn Gästen bei solchen Bällen war ein »von«, was zeigt, dass diese Familien nur in einem sehr eingeschränkten Ausmaß mit Adelskreisen verkehrten; die meisten Gäste waren von jüdischer Abstammung. Einige dieser Rosenbergs, Eggers, Mandls, Mondscheins, Luzzattos, Pollaks, Schweinburgs und Bambergers waren aus der Kultusgemeinde ausgetreten, andere nicht. Gretls einzige Reaktion auf diese Gesellschaft drückt die Antipathie aus, die viele Konvertiten fühlten, wenn sie ihre alte Identität abwarfen: Sie beschrieb ein bei einem Ball bei den Mandls aufgeführtes Stück als »jüdischen Protz«.
Gretl als Elfjährige bei ihrem ersten Ball, um 1908.
Gretl hielt die Namen der jungen Männer fest, mit denen sie sich unterhielt, und jene, die sie am interessantesten fand; immer beurteilte sie die Qualität der Konversation. Sie schrieb auch nieder, neben wem sie bei Tisch saß, wer ihr am Buffet die Speisen reichte, und beschrieb den Zimmerschmuck, das Essen und Trinken mit einem scharfen Auge für die Präsentation. Die einzige Marke, die sie erwähnte, war die WW, das Monogramm der Wiener Werkstätte, das die Verkaufsstätten, das Einwickelpapier und viele der Waren zierte. Bei einem von den Freunden ihrer Eltern, den Luzzattos, veranstalteten Ball wurden die Frauen alle mit Blumen beschenkt, die mit WW-Bändern umwunden waren. Bei einem anderen verwendeten die Gastgeber WW-Tischkarten.
Die Unterhaltung bei diesen Hausbällen war unterschiedlich. Einmal gab es Filme, gelegentlich Verlosungen, Lotterien oder Glücksspiele. Oft gab es Vorführungen, manchmal amateurhaft durch Gäste, öfter durch professionelle Zauberer, Kabarettkünstler oder Schauspieler.
Weitere Kostenlose Bücher