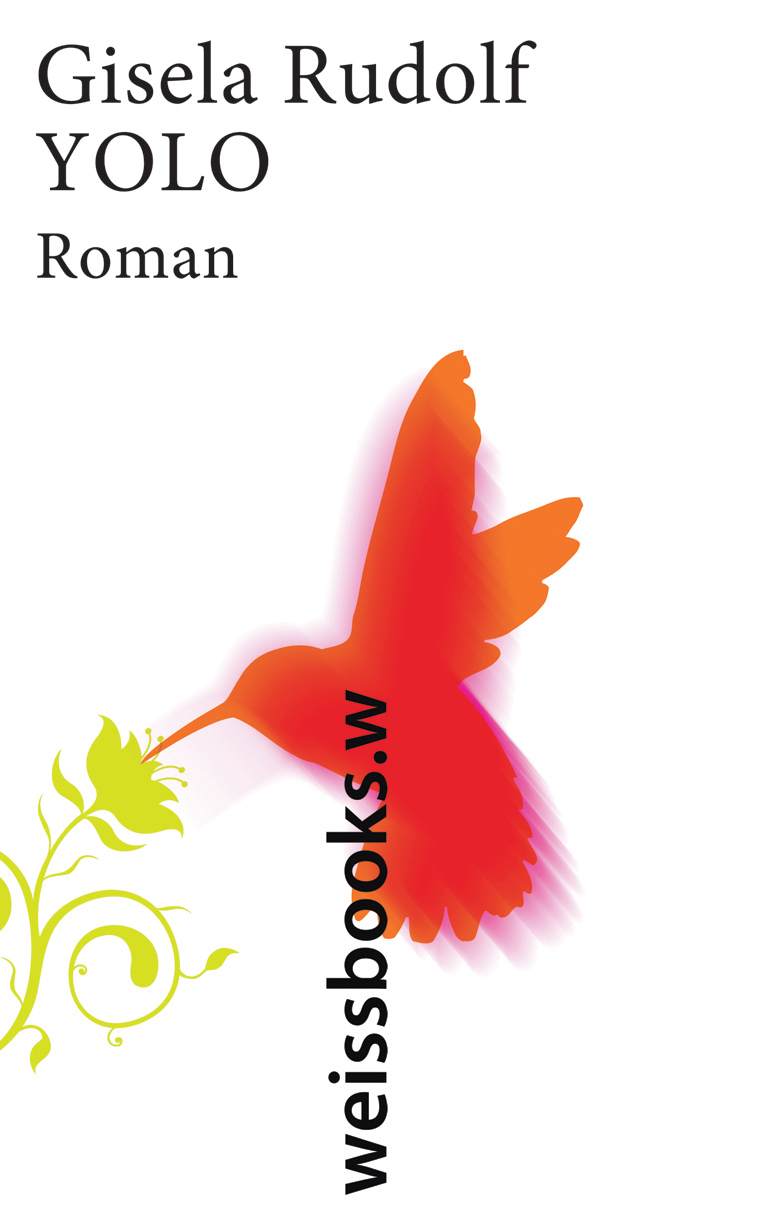![Yolo]()
Yolo
allmählich ins Plaudern: »Schließlich geht es unsereins doch gut. Ich habe ja Luc, der bei mir bleibt, auch wenn er mich nicht heiraten kann, nicht wahr? Weißt du, zum Single tauge ich nicht. Und du? Ich brauche einfach einen Mann, Frauenemanzipation hin oder her. In der Gesellschaft bist du als Single nach vierzig doch niemand mehr. Ich habe das nach der ersten Scheidung erfahren müssen: Die Männer im idealen Alter plagen sich mit Altlasten herum; Bumsen ja, aber um Gotteswillen keine feste Beziehung! Ehepaare laden dich als Einzelperson auch nicht gern ein, und wenn du das Pech hast, arbeiten zu müssen, schnappen dir Jüngere die Stellen weg oder mobben dich aus dem Job. Geschiedene werden zur Person non grato, oder wie das heißt. Erfährst du dies als Ledige nicht ähnlich?«
Ich als Ledige.
Tanjas Bemerkung bleibt an mir haften wie der üble Nachgeschmack eines schlechten Essens.
Bis heute hat es das nur ein einziges Mal gegeben, dass ein Mann mich wirklich heiraten wollte. Alessandro. Er hätte alles dafür gegeben. Auch unserem Kind zuliebe. Aber ich war zu jung und er zu alt. Und überhaupt. Mir war Anderes wichtiger, obwohl ich jetzt nicht mehr weiß, was. Was konnte wichtiger sein, zumal das, was ich tat, ja doch nur zu meinem Scheitern führte?
Ob er noch an der Uni ist? Etwa schon emeritiert, weil er nicht mehr in Florenz wohnt? Mit Kindern? Nein, eine Familie hat der nicht. Er ist der geborene Junggeselle, auch das war damals ein Grund, mich gegen eine gemeinsame Zukunft zu entscheiden. Zudem sind alle Italiener untreu, und wenn du einen heiratest, heiratest du gleich seine ganze Sippschaft dazu. Das sind Dinge, die ich mit zwanzig wusste. Und ich wusste auch, dass mir das Leben noch sehr, sehr viel bieten würde.
Siebzehn Jahre liegt unsere Trennung zurück. Seither habe ich Florenz mit Ausreden gemieden, an die ich selber geglaubt habe.
In die Stadt geriet ich seinerzeit eher zufällig. Ich musste eine abgewiesene Arbeit neu schreiben und wollte mich dazu irgendwohin zurückziehen. Die Tante einer Freundin bot mir an, bei ihr zu wohnen, sie war einsam und brauchte Gesellschaft. Eine eigenwillige Italienerin war diese Zia Giuseppina. Was ihr gefiel, hatte jedem zu gefallen, und was sie nicht mochte, durfte keiner mögen. Den Titel meiner Arbeit –
Das Vulgärlatein als Ursprache des Romanischen
– fand sie absurd; schon nach einer Woche witzelten die Stammgäste ihrer Bar mit mir über die Faszination des Vulgären.
Keine sieben Tage in der fremden Stadt, lernte ich an der Uni Dottore Alessandro Cabrese kennen. Er war einer der jüngsten Professoren und sah genau so aus, wie ich mir einen attraktiven Italiener ausgemalt hatte. Obwohl Mathematiker, nahm er sich väterlich meiner Spracharbeit an. Meiner Arbeit – und mir. Ich zog zu ihm und lebte bei ihm, bis ich schwanger wurde. Dann ging ich heim, nicht direkt – Amsterdam galt damals als Hochburg unkomplizierter Abtreibungen.
Die letzten gemeinsamen Wochen hatten wir im Landgut seiner Eltern in Vicchio verbracht. Wir könnten dort ständig wohnen, wir drei, schwärmte er. Redete vom Kind, als wäre es bereits geboren. Und mir kam vor, als würde er mich mit unsichtbaren Fäden einpuppen. Ich sah mich neben seiner alten Mamma selbst alt werden, ohne das wahre Leben je ausgeschöpft zu haben. Plötzlich kam er mir mit seinen Dreiundvierzig mehr als reif vor. Zu ausgewogen, zu gefestigt, vernünftig bis zur Langeweile. Jedenfalls weit weg von jener Unvernunft, die mir geradezu als Pflicht meiner Jugend erschien. Ich war voller Enthusiasmus, hatte fantastische Pläne. Nie zuvor war ich so sehr vom Leben angetan, das an einem anderen Ort auf mich wartete.
Nach Amsterdam fühlte ich mich frei wie ein Vogel. Nun konnte das richtige Leben beginnen! Ein Leben wie in Italien, jedoch unverplant, mit einem Alessandro, der jung war wie ich und Lust auf Abenteuer hatte.
Vor dem Nachtessen will ich in der Bibliothek die Zeitungen durchblättern. Der Tea-Room-Betrieb ist bereits eingestellt, Wirtin Trude fort. Einzig Feigenblatt sitzt an einem Tisch – er spielt wieder Schach.
»Ist das denn alleine interessant?«
Ohne hochzusehen, nickt er.
»Steht man denn als Solospieler nicht im Vornherein auf der weißen oder schwarzen Seite? Da kann doch niemand neutral bleiben, wenn …«
»Doch, doch, ich spiele nicht parteiisch. Ohne Gefühle geht das gut.«
»Also, da bin ich viel zu viel Frau, ich kann meine Gefühle nie abstellen.«
»Spielen
Weitere Kostenlose Bücher