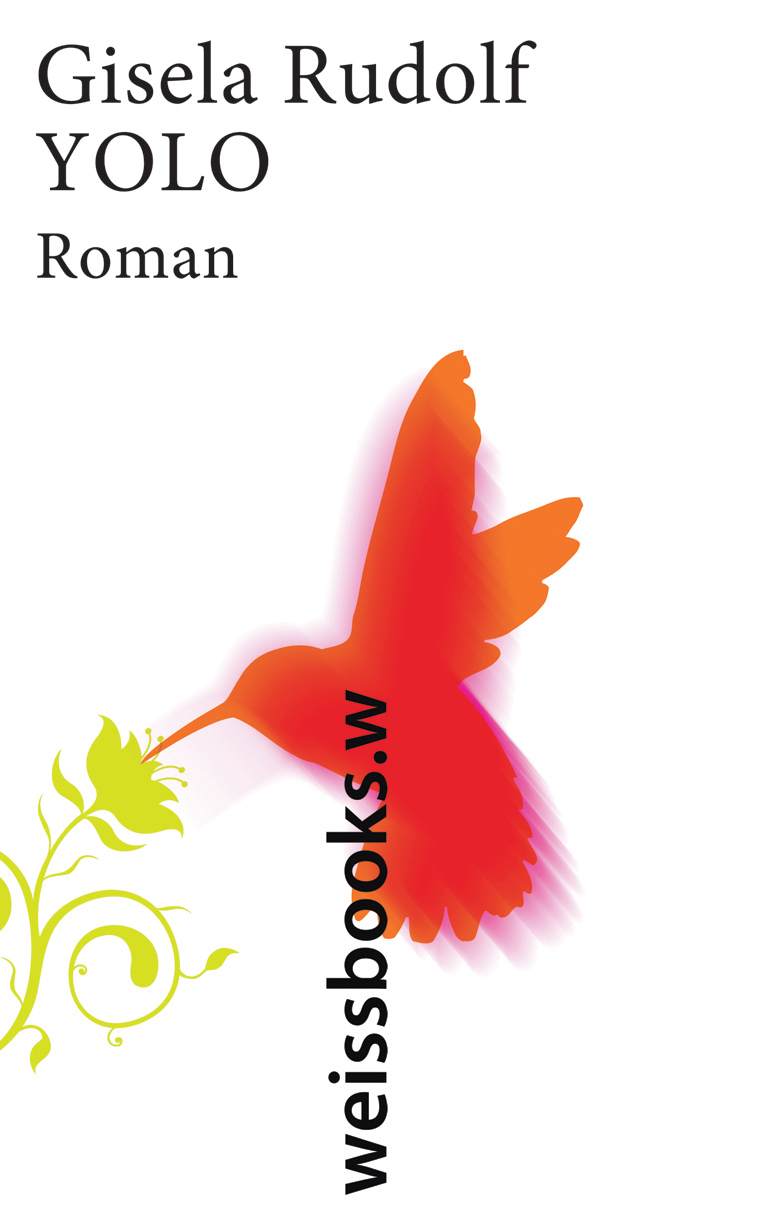![Yolo]()
Yolo
»Gestern hat mich ein Schüler besucht. Er war der Freund einer Schülerin, die kürzlich verunglückt ist.«
»Dieser Sonja, Ihrer Lieblingsschülerin?«
»Sie wissen Ihren Namen noch?«
»Ich mache mir zwischendurch Notizen. Weshalb ist dieser Schüler zu Ihnen gekommen?«
»Das habe ich ihn auch gefragt. Gefühle der Dankbarkeit, hat er gesagt. Sonja habe ihm kurz vor ihrem Tod noch erklärt, dass ich in der Zeit ohne ihn – er hatte zeitweilig mit ihr Schluss gemacht – ihre größte Stütze gewesen sei … Übrigens, ich habe die Kündigung noch gestern Abend zerrissen. «
»Erst gestern?«
»Ja. Ich habe den Brief erst gestern fortgeworfen. Und es ist für mich nicht nur vorstellbar, ins Schulzimmer zurückzukehren, es ist jetzt schon mehr als das.«
Sein zufriedenes Nicken, endlich wieder einmal von einem Lächeln begleitet, versöhnt mich etwas mit seiner selbstgefälligen Art.
»Ich müsste ja eigentlich noch ein, zwei Wochen in der Klinik bleiben. Wie ist das, könnte ich …«
»Frühzeitig heim?«
»Ja, ich meine, wenn ich …«
»Nein, Frau Dornbach, davon rate ich dringend ab.«
»Könnte ich wenigstens übers Wochenende heim? Nur Freitag bis Sonntag. Ich möchte etwas in Ordnung bringen, das wichtig für mich ist.«
»Und das hier ist nicht wichtig?«
»Ja, sie haben Recht, es ist ja auch nur so ein Spleen.«
»Spleen kommt vom Lateinischen und bedeutet eine durch eine kranke Milz hervorgerufene Gemütsverstimmung.«
»Danke, Herr Lehrer. Und die Milz ist irgendwo im Bauchraum, oder? So ist es eben, eine Bauchentscheidung, weder logisch noch konsequent. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie falsch sein muss.«
Heute trägt mein Doktor keine Jesuslatschen: schwarze Socken, beiger Sakko, selbstverständlich mit hochgestülpten Ärmeln, das Hemd bis zu den Brusthaaren geöffnet. Er hat nachher wohl noch eine Konferenz.
Da Moeller nicht wissen will, was ich denn zu Hause Wichtiges tun muss, und die fünfundvierzig Minuten noch immer nicht um sind, frage ich, ob ich ihm einen Traum erzählen soll. Er nickt, und schon verkaufe ich dem Zuhörer Tanjas Traum vom niesenden Häuschen als den meinen. Zum Schluss füge ich hinzu: »Zufrieden, dass ich so Lustiges träume?«
Ich suche nach einem Ansatz von Amüsement in seinem Gesicht.
Moeller macht keinerlei Anstalten, das Gespräch aufzunehmen. Ihn stört das gegenseitige Anschweigen weniger als mich. Er wird für sein Dasitzen ja auch fürstlich honoriert.
Endlich doch: »Haben Sie an sich gewisse Veränderungen festgestellt?«
»Nun, ich schreibe mir neuerdings Gedanken auf, und zwar in einer speziellen Agenda.«
»Agenda? Interessant.«
»Ich habe mir im Dorf eine nagelneue Agenda gekauft, mitten im Jahr! Alle Seiten darin sind noch weiß, ich kann zurückblättern bis zum Januar und wieder nach vorne bis in diese Septembertage hinein, und nichts zeugt da von tausend Terminen und Engpässen und Beerdigungen, und was mich sonst noch alles in die Knie gezwungen hat.«
»Versuchen Sie dadurch nicht, die letzten Monate zu verdrängen? Es geht doch darum …«
»… aus Erfahrungen zu lernen und Fehlverhalten zu korrigieren. Das entspricht ihrem therapeutischen Ansatz. Aber, entschuldigen Sie, Herr Moeller, es gibt doch nicht bloß eine einzige Möglichkeit der Therapie, ich meine, es gibt doch auch im Schulzimmer nicht nur eine Möglichkeit des Unterrichts, obwohl das Ziel immer dasselbe ist.«
»Was versprechen Sie sich von der Agenda?«
»Nichts. Absolut nichts. Das ist ja der Reiz der Sache: Ich habe etwas ohne Zweck gekauft und ohne Sinn, das finde ich einfach schön. Ich trage die Agenda immer bei mir, und wenn ich sie sehe, fühle ich mich gut, weil sie nichts von mir will. Sie hetzt mich zu keinem Termin, mahnt mich nicht an Stichtage … Geht mir aber etwas durch den Kopf, schreibe ich es hinein. Ganz nach dem Zufälligkeitsprinzip, auf irgendeine der leeren Seiten.«
»Das machen Sie gut so.«
Während der Psychiater seine Notizblätter ordnet – untrügliches Zeichen für das Ende der Sitzung –, sagt er:
»Um noch einmal auf Ihre Frage zurückzukommen. Wochenendausflüge sind hier wirklich nicht Usus, und als Ihr Arzt rate ich Ihnen davon ab. Wenn Sie das Wochenende zu Hause verbringen wollen, ist es Ihre Entscheidung, Sie alleine tragen die Verantwortung.«
Ich sitze gerne im Foyer neben der Rezeption. Hier nimmt man am Klinikalltag teil, ohne involviert zu sein. Das Läuten des Telefons, die Stimmen der
Weitere Kostenlose Bücher