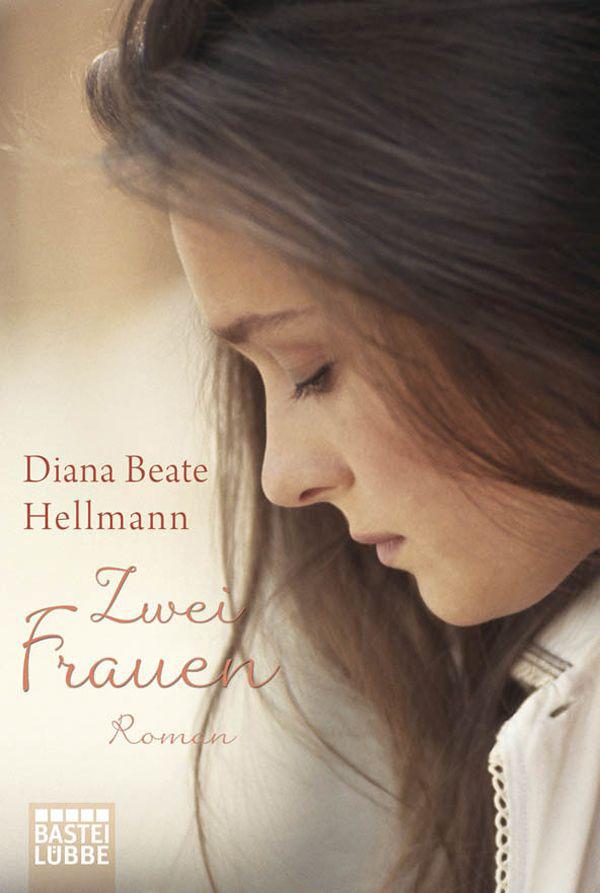![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
Man glaubt, das ganze Leben läge noch vor einem wie ein aufregendes Abenteuer. Das sagen die Älteren ja auch immer. Gerade war man noch ein Kind und für alles zu klein. Endlich ist man groß genug und will die Welt aus den Angeln heben, alles verändern … ist es nicht so?«
Es war so, genauso war es. Aber ich verstand nicht, was das mit mir zu tun haben sollte. Ich konnte es mir nicht vorstellen, ich wollte es mir nicht zusammenreimen. Ich saß nur da, einfach so.
»Machen Sie es mir doch nicht so schwer«, bat Mennert, und dabei umfasste seine große, warme Hand meine dürren, kalten Fingerchen noch fester als zuvor. »Sie sind doch ein intelligentes Mädchen, im Grunde wissen Sie doch genau, was ich Ihnen zu sagen habe.«
Das war eine haltlose Unterstellung. Ich wusste es nämlich nicht, ich wusste es wirklich nicht, da war nur so ein Gedanke, ganz tief in meinem Hinterkopf, weit weg, unerreichbar.
Mennert atmete tief. »Also gut, Eva … Sie haben Krebs! Genauer … Lymphosarkome. Das bedeutet … die Prognose ist ungünstig, Sie …«
»Ja?« Mit großen Augen sah ich ihn an und spürte, wie ich glühte. Da war plötzlich eine Hitze in mir, die mich fast verbrannte, mein ganzer Körper schien unter ihr zu versengen.
»Es tut mir Leid«, flüsterte Mennert, »es tut mir Leid.«
Meine Gedanken rasten. Wie Torpedos schossen sie durch mein Hirn, fanden nirgends einen Ausgang, stießen schmerzend gegen verschlossene Türen. Ich fürchtete schon, mein Kopf würde auseinander bersten. Wegen ein paar lächerlicher Knoten war ich in diese Klinik gegangen, hatte mich piesacken und belügen lassen. Alle hatten gelogen. Vielleicht waren auch Mennerts Worte nichts als dramatisch verpackte Lügen.
»Leid tut es Ihnen?«, hörte ich mich plötzlich fragen, und dabei kam mir meine eigene Stimme fremd vor. Sie klang so kalt, so bitter, so böse.
Mennert war entsprechend ratlos. »Sie haben es gewusst«, sagte er, »nicht wahr?«
Ich lachte laut auf. »Weil ich nicht heule? Nicht herumschreie?«
»Ich werde die Schwester bitten, Ihnen ein Beruhigungsmittel zu geben!«
»Nein!«
Er hatte aufstehen und fliehen wollen, aber ich hielt ihn im letzten Moment am Ärmel seines Kittels zurück. Ein Knopf sprang ab, flog gegen die Wand und fiel dann zu Boden, trudelte, blieb liegen. Ich hätte ihn am liebsten zertrampelt, diesen elenden Knopf, alles hätte ich am liebsten zertrampelt, alles.
Warum ich so empfand, verstand ich selbst nicht. Da war kein Schmerz in mir, keine Angst; dieses Wort Krebs vermochte derartige Regungen einfach nicht mehr in mir auszulösen, zu oft hatte ich es in den vergangenen Wochen gehört. Es war für mich kein Schicksal und kein Urteil mehr, nur noch ein Wort mit fünf Buchstaben. Dieses Wort hatte Mennert ausgesprochen, mehr noch, er hatte es mir an den Kopf geworfen und geglaubt, das würde reichen, weil ich seines Erachtens ja ein intelligentes Mädchen war. Damit hielt er seine gottverdammte Medizinerpflicht für getan.
» Nein!!! – Was bilden Sie sich eigentlich ein?«, fuhr ich ihn an. »Sie kommen hier herein und halten lange Reden. Sie faseln über die Träume junger Menschen und erklären mir, ich sei doch ein intelligentes Mädchen. Wissen Sie, wie mir das vorkommt? Das ist wie früher in der Schule im Mathematikunterricht. Da haben die Lehrer auch immer gesagt: ›Aber Eva-Kind, wenn a plus b in Klammern zum Quadrat gleich x ist, dann ist doch völlig logisch, was y ist, du bist doch ein intelligentes Mädchen!‹ – Bedaure! Diese hochgeschraubten Erwartungen habe ich nie erfüllen können.«
Ich schrie mehr, als dass ich sprach, und Mennerts Gesicht war anzusehen, wie sehr mein Verhalten ihn erschreckte. Ich verstand es ja selbst nicht. Mein Kopf war klar, meine Zunge war spitzer denn je, ich fühlte mich da wie nie zuvor in meinem Leben.
»Eva«, hob er zaghaft an und wollte schon wieder nach meiner Hand greifen. Ich ließ weder das zu noch ließ ich ihn zu Worte kommen.
»Ich habe also Krebs«, erklärte ich stattdessen. »Oder Lympho-Dingsda, – gut! Aber was geschieht denn jetzt mit mir? Sagen Sie mir das endlich, ich habe ein Recht darauf zu –«
»Wir werden Sie therapieren!«, fiel Mennert ruhig ein.
»Wie?«
»Mit Medikamenten. Vorerst.«
»Und dann?«
»Werden wir weitersehen.«
Ich stöhnte laut auf. Ganz abgesehen davon, dass man diesem Professor offenbar jede Information einzeln aus der Nase ziehen musste, hatten mich Worte wie »vorerst« und
Weitere Kostenlose Bücher