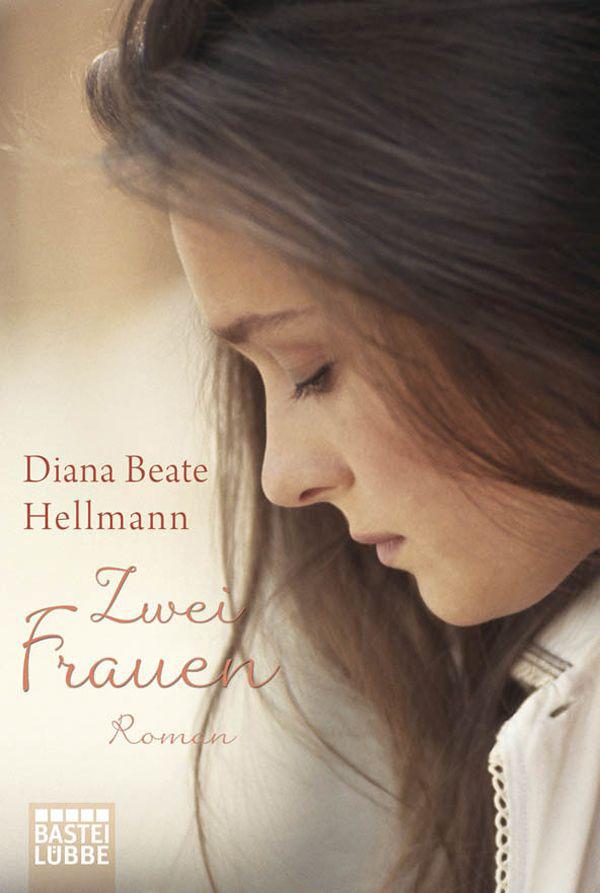![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
einfach.
Ich wollte leben! – Aber was war schon das Leben? Mit Worten war es nicht zu beschreiben, Bilder spiegelten es nur mangelhaft wider, es wollte halt gelebt sein.
Ich wollte gesund werden! – Aber was war Gesundheit? Sie war einer jener Gäste der menschlichen Natur, die man erst dann bemerkt, wenn sie einen verlassen. Sehnsucht verspürte ich lediglich nach ihren Begleiterscheinungen. Als ich noch gesund gewesen war, konnte ich tanzen … tanzen …
Ich wollte tanzen! – Das war der Punkt. Das Ballett hatte Farben und Formen, man konnte es anfassen, sich einfühlen, darin eintauchen. Ich schloss die Augen und sah die Schweißperlen auf meinem Gesicht, spürte das durchnässte Trikot auf meiner dampfenden Haut. Ich hörte Tschaikowskys Geigen, und meine Sehnsucht wurde zu einem Feuerball, der alles erhellte.
Das war vielleicht verrückt, aber es war greifbar. Es war der Anfang, mein Kreis erwachte zum Leben und barg mich fortan fest in seiner Mitte. Ich wollte tanzen, und deshalb musste ich gesund werden und leben. Was ich wollte, hatte ich noch immer erreicht. Mein Wille war Berge versetzend, mein Selbstvertrauen gigantisch. Ich konnte es schaffen, das fühlte ich, vor allem aber wollte ich es schaffen … unbedingt!
KAPITEL 12
Meine Eltern trauten sich erst einige Tage nach Mennerts Eröffnung wieder her und waren sichtlich überrascht, dass ich trotz Mennerts Diagnose noch lange nicht aufgegeben hatte. Vor allem meine Mutter versuchte, mir jeden Wunsch von den Lippen abzulesen.
Ich ließ mir Musikkassetten, Lippenstifte, Zeitschriften bringen – und alles, was an Büchern über Krebs auf dem Markt war.
Claudia war über mein Verhalten nicht weniger überrascht als meine Eltern.
»Dat hätt ich dir echt nich zugetraut«, sagte sie anerkennend, »ich hab gedacht, du bis eine von die Tussis, die dat Handtuch schmeißen, wenn se hören, dat de Kacke am Dempen is.«
»Dass was?«
»Dat se schlechte Katen ham!«
Ich seufzte vernehmlich, denn Claudias Ausdrucksweise war mir nach wie vor eine Qual. Nicht nur die Fäkalsprache an sich machte mir zu schaffen, es war auch die verbalhornte Grammatik, die krächzende Stimme. Manchmal hätte ich mir am liebsten Watte in die Ohren gestopft.
Was die gewünschte Krebsliteratur anging, so scheuten meine Eltern weder Kosten noch Mühe. Eine wahre Bücherflut brach über mich herein, ein Wust von Papier und Fremdworten. Claudia grinste nur. »Hier!«, rief sie und warf mir einen Wälzer zu, der noch dicker war als die anderen.
»Was ist das?«
»En Fachlexikon. Pschyrembel. Dat brauchse.«
Ich arbeitete mich mühsam durch die wissenschaftliche Krebsliteratur, musste aber feststellen, dass die Fachwelt über meine Krankheit nichts Genaues zu wissen schien: »Das Gebiet der malignen Lymphome ist nach wie vor unzureichend erforscht. Die Nomenklatur ist daher vielschichtig«, las ich in einem Standardwerk. Trotzdem gab ich nicht auf und wandte mich an Professor Mennert.
Er bestand darauf, dass sich der Patient mit der Krankheit beschäftigte, dass man sie nie verdrängte.
»Das ist dann nämlich genau der Moment, auf den die Zellen warten«, sagte er. »Der Körper ist entspannt, der Geist ist mit anderen Dingen beschäftigt, und prompt platzt die Bombe: Aus tausend Killern werden zweitausend!«
Das leuchtete mir ein, aber es bereitete mir auch Kopfzerbrechen. »Wie kann ich mich dagegen denn schützen?«, fragte ich.
»Sie müssen kämpfen, Eva!«
Ich nahm seinen Vorschlag ernst, verzichtete auf Schlaftabletten und nahm die Konzentrationsübungen wieder auf, die ich im Yoga-Unterricht unter Frau Gruber widerspenstig gelernt hatte.
Ich legte mich flach in mein Bett und dachte mich in den Stirnpunkt zwischen meinen Augen. Dann atmete ich tief in den Bauch, in die Brust und in die Schultern, und beim Ausatmen stieß ich all die frei werdende Kraft in diesen einen Punkt. Wenn ich glaubte, nur noch aus diesem einen Punkt zu bestehen, begann ich, in die einzelnen Glieder zu atmen. Das war ganz einfach. Bauch, Brust, Schultern, Luft anhalten – ausatmen und hinein in den rechten Fuß! Den hielt ich danach für keimfrei, der hatte nun Kraft und würde die bösen, bösen Krebszellen vernichten wie Tarzan die bösen, bösen Elefantenjäger. Schichtweise arbeitete ich mich so durch den ganzen Körper, und wenn ich an den Haarwurzeln angelangt war, begann ich wieder von vorn.
Claudia fand das äußerst erheiternd. »Wate ma ab, bisse mit die Chemotherapie
Weitere Kostenlose Bücher