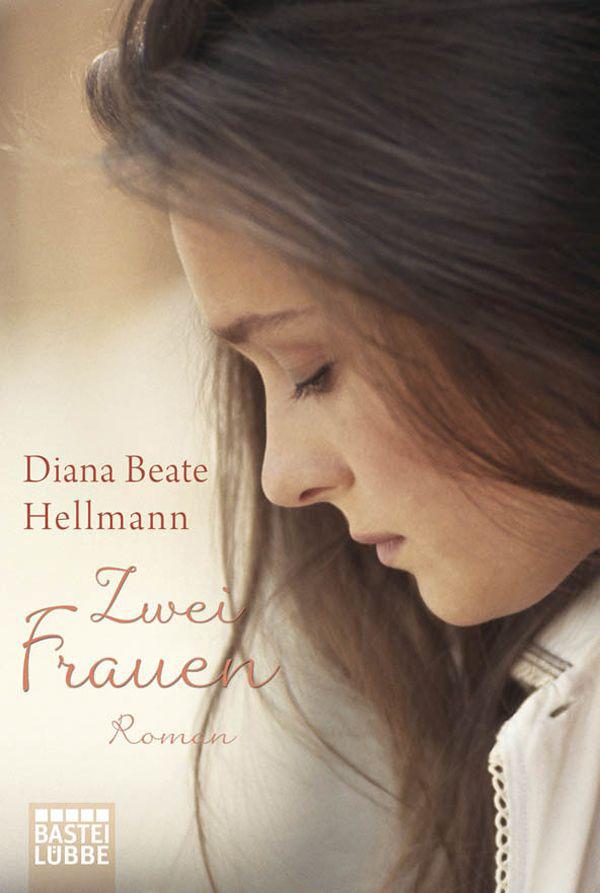![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
verspreche es Ihnen«, sagte Mennert.
»Tun Sie mir dann gleich noch einen Gefallen?«, fügte ich hastig hinzu.
»Wenn ich kann.«
»Gehen Sie, bitte! Bitte!!!«
Er sah, was mit mir los war, und er wusste wohl auch, dass ich in seiner Gegenwart niemals in die erlösenden Tränen ausgebrochen wäre.
»Natürlich!«, sagte er leise.
Dann stand er auf und ging. Und ich war allein. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich auf die geschlossene Zimmertür und fing an zu weinen, wie auf Kommando, lautlos, ohne ein einziges Aufschluchzen, ohne Gefühl. Diese Tränen, die mir da über das Gesicht rannen, schmeckten nicht einmal salzig.
Als es vorüber war, kletterte ich aus dem Bett und trat ans Fenster. Drüben in der Kinderklinik wurde gerade das Mittagessen ausgeteilt, und zwei kleine Mädchen stritten um einen Teller … das Leben ging weiter. Ich sah, dass die Sonne immer noch schien, ich hörte, dass die Vögel immer noch sangen … die Welt hörte nicht auf, sich zu drehen.
Das wollte mir nicht in den Sinn. Ich war hier drinnen eingesperrt, vor mir lag eine Zukunft, die ich statistisch gesehen eigentlich gar nicht mehr hatte, und diese Welt da draußen machte weiter, als wäre nichts geschehen, als ginge sie das überhaupt nichts an. Sie nutzte die Zeit, die mir nun nicht mehr blieb.
Da fiel mir plötzlich auf, dass ich ja nie Zeit gehabt hatte. Immer war ich in Eile gewesen, in pflichtbeflissener Hektik. Ich hatte keine Zeit, meine Eltern zu besuchen, mich mit Freunden zu treffen, zu telefonieren, einen Brief zu schreiben … keine Zeit! Ich hatte auf die Uhr gesehen und geglaubt zu wissen, wie spät es war, und ich hatte dabei verkannt, dass ich selbst die Zeit war. Ich war verronnen, mit jeder Stunde, mit jedem Augenblick. Jetzt war es zu spät. War es wirklich schon zu spät?
Mein Blick glitt über das frische Grün der Lindenzweige hinab auf die ersten Blumen im Park. Ich schaute hinauf in den wolkenlosen Himmel, in die Sonne. Ich hatte mich immer für einen Teil des Ganzen gehalten, für ein Rädchen, das gebraucht wurde, ohne das der Mechanismus nicht funktionierte. Plötzlich wusste ich es besser. Ich war ein Teil des Ganzen, aber in all meiner Winzigkeit war ich gebaut wie das große Ganze. Ich war ein Mikrokosmos. Ich lebte, aber Gott hatte nicht mich persönlich, sondern das Leben schlechthin geschaffen. Ich war mein Leben, nicht zufällig, nein, von göttlicher Hand so gelenkt. Anfang und Ende lagen in mir, nicht außerhalb. Ich war alles und nichts.
Die Zweige der Linde wogten im Wind, die Knospen der Blumen brachen auf im Sonnenlicht, die Natur erblühte und verging im steten Wechsel der Jahreszeiten, nichts verlor sich, alles war eingebunden in einen Kreislauf ewiger Schöpfung. Wenn etwas endete, begann zugleich etwas Neues. Aber galt das auch für mich? Wo würde ich sein, wenn ich nicht mehr hier wäre?
Wenn ein Bein ab war, war es ab und wuchs nicht nach. Das war mir klar. Trotzdem keimte so etwas wie Hoffnung in mir. Vielleicht war ich ja wie ein Baum, der im Herbst seine Blätter verlor, um in einem neuen Frühling neu zu ergrünen. Vielleicht war ich aber auch nur ein Blatt am Baum der Ewigkeit, das in eine trübe Regenpfütze stürzte und zerfiel.
Diese Gedanken halfen mir nicht weiter. Sie waren ein Labyrinth, aus dem es kein Entrinnen mehr gab, wenn man erst einmal tief genug vorgedrungen war. Das wollte ich aber nicht riskieren. Ich wollte einen klaren Kopf behalten. Ich wollte mich mit meinem Schicksal einfach nicht abfinden.
Schicksal war für mich schon immer das gewesen, was man aus seinem Leben machte. Das Schicksal war vielleicht eine Macht, das gab ich gern zu. Dieser Macht hatte ich aber meinen Willen entgegenzusetzen, die Hoffnung auf Gottes Unterstützung.
»Möge Gott mir die Kraft geben, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann; den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann; und die Weisheit, zu unterscheiden.«
Dieser Satz, der in der Bibel meiner Oma Tati geschrieben stand, war im Laufe der Jahre zu meinem elften Gebot geworden. Er war der Grund für meine mangelnde Demut gegenüber dem Schicksal. Demütig konnte ich ja immer noch sein.
Vorher musste ich aber erst versuchen, das Unmögliche doch noch zu schaffen. Ich musste … musste …
Diese Gedanken waren schon wesentlich fruchtbarer. Ich zwang mich, sie in eine Reihenfolge zu bringen, einen Kreis zu schließen, an dem ich mich festhalten und hochziehen konnte. Das war gar nicht so
Weitere Kostenlose Bücher