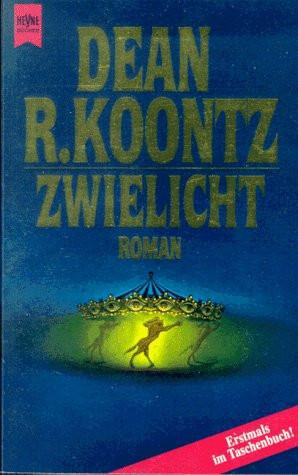![Zwielicht]()
Zwielicht
sofern der Mond scheint.«
Abgesehen von ihrem strengen Vortrag über die Arbeit am ›Lukas‹ war das die längste Rede, die ich bisher von ihr gehört hatte, und sie bemühte sich offenbar, einen Kontakt zu mir herzustellen, aber ihre Stimme blieb dabei so unpersönlich und geschäftsmäßig wie während der Arbeitszeit. Ja, sie war sogar eher noch kühler als zuvor, denn jetzt fehlte ihr das Stimulans des Geldverdienens. Es war eine ausdruckslose, gleichgültige Stimme, so als verlöre Rya jedes Interesse am Leben, sobald der Rummelplatz schloß, und erlangte es erst am nächsten Vormittag bei Öffnung der Tore wieder. Ohne das besondere Gespür, das ich meinem sechsten Sinn verdankte, hätte ich vielleicht gar nicht bemerkt, daß sie menschlichen Kontakt benötigte und mich zu erreichen versuchte. Ich wußte, daß sie sich bemühte, freundlich zu sein, aber das fiel ihr denkbar schwer.
»Heute nacht scheint der Mond«, sagte ich.
»Ja.«
»Und es gibt Wiesen in der Nähe.«
»Ja.«
»Und Wälder.« Sie starrte ihre nackten Füße an.
»Ich wollte selbst einen kleinen Spaziergang machen«, murmelte ich.
Ohne mich anzusehen, ging sie zum Lehnstuhl, wo ihre Tennisschuhe standen, schlüpfte hinein und kam auf mich zu.
Wir ließen Gibtown-auf-Rädern hinter uns und gingen durch die Wiesen, wo das wilde Gras im Mondschein silbrig schimmerte. Es war kniehoch und mußte ihre nackten Beine kitzeln, aber sie beklagte sich nicht. Wir liefen schweigend dahin, anfangs, weil wir beide zu unbeholfen waren, um ein Gespräch zu beginnen, dann aber, weil es plötzlich unwichtig schien, ob wir uns unterhielten oder nicht.
Am Ende der Wiese wandten wir uns nach Nordwesten und schlenderten am Waldrand entlang. Hier spürten wir eine willkommene Brise im Rücken. Der nächtliche Wald schien nicht aus einzelnen Tannen, Birken und Ahornen zu bestehen, sondern aus einer unüberwindlichen stabilen Festungsmauer. Nach etwa einem halben Kilometer tauchte zwischen den Bäumen aber ein schmaler Weg auf, der in den finsteren Wald hineinführte.
Ohne uns abzusprechen, bogen wir auf diesen Weg ein. Nach 200 Metern fragte sie unvermittelt: »Träumst du?«
»Manchmal«, antwortete ich.
»Wovon?«
»Von Trollen«, sagte ich wahrheitsgemäß, obwohl ich wußte, daß ich lügen würde, falls sie Näheres wissen wollte.
»Alpträume«, stellte sie nüchtern fest.
»Ja.«
»Hast du meistens Alpträume?«
»Ja.«
Obwohl die Berge von Pennsylvania meiner Ansicht nach bei weitem nicht so eindrucksvoll waren wie die Siskiyous, herrschte hier doch eine ehrfurchtgebietende Stille, wie sie nur in der Wildnis zu finden ist, majestätischer als in einer Kathedrale, und wir dämpften unwillkürlich unsere Stimmen und unterhielten uns fast im Flüsterton, obwohl niemand uns hören konnte.
»Ich auch«, sagte sie. »Alpträume. Nicht nur meistens. Immer.«
»Trolle?« fragte ich.
»Nein.«
Sie verstummte wieder, und ich wußte, daß es sinnlos wäre, in sie zu dringen. Sie würde mir nur dann mehr erzählen, wenn ihr selbst danach zumute war.
Wir liefen nebeneinander her. Auf beiden Seiten umgab uns dichter Wald. Der Weg hatte im Mondschein einen grauen Schimmer, so als wäre Gottes Thronwagen mit Feuerrädern hier durchgebraust und hätte eine Aschenspur hinterlassen.
Nach einer Weile sagte Rya: »Friedhöfe.«
»In deinen Träumen?«
Ihre Stimme wurde noch leiser. »Ja. Es ist nicht immer derselbe Friedhof. Manchmal erstreckt er sich auf ebenem Gelände bis zum Horizont, ein Grabstein hinter dem anderen, und alle sehen genau gleich aus.« Sie hauchte jetzt nur noch. »Und manchmal ist es ein verschneiter Friedhof auf einem Hügel, mit kahlen schwarzen Bäumen und mit terrassenförmig angeordneten Grabsteinen verschiedenster Art — Marmorobelisken und niedrige Granittafeln und verwitterte Statuen... und ich gehe den Hügel hinab... in Richtung der Straße, die aus dem Friedhof hinausführt... ich bin sicher, daß es dort irgendwo eine Straße geben muß... aber ich kann sie einfach nicht finden.« Ihre Stimme klang jetzt so trostlos, daß mir ein kalter Schauder über den Rücken lief, so als hätte man mir eine eisige Klinge auf die Haut gelegt. »Zuerst bewege ich mich langsam zwischen den Grabmälern hindurch, weil ich Angst habe auszurutschen und in den Schnee zu fallen; aber wenn ich schon ein ganzes Stück hinabgestiegen bin und unten noch immer keine Straße sehe, gehe ich allmählich schneller... und immer schneller... und
Weitere Kostenlose Bücher