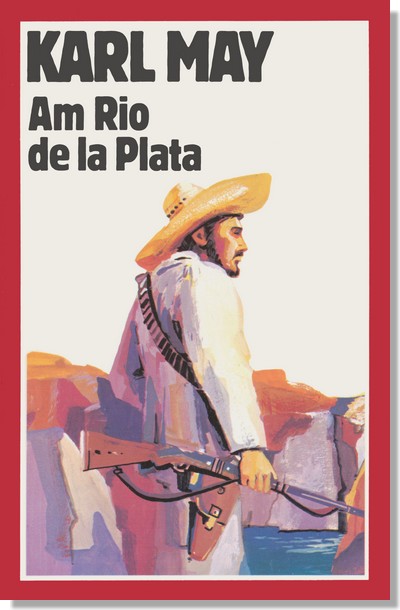![34 - Sendador 01 - Am Rio de la Plata]()
34 - Sendador 01 - Am Rio de la Plata
Gewandes.“
„Leder? Ah! O! Also ist –“
Er hielt inne.
„Weiter! Was wolltest du sagen?“ fragte der Frater.
„Nichts, gar nichts; ich bin nur so sehr erschrocken.“
Aber ich wußte wohl, was er hatte sagen wollen. Daß ich ein ledernes Gewand hatte, war die Veranlassung seines unterbrochenen Ausrufes gewesen. Er mußte also von meiner hierzulande auffälligen Kleidung wissen. Er konnte von ihr nur durch die Bolamänner erfahren haben. Folglich befanden sie sich hier, und zwar gar nicht etwa weit entfernt. Der Bruder ließ sich täuschen und sagte:
„Erschrocken bist du? Das könnte aber diesen Señor nicht retten, wenn der Pfeil ihn getroffen hätte. Petro, Petro, das hätte ich von dir nicht gedacht, daß du ein Mörder bist!“
„Ich, ein Mörder? Oh, Bruder, wie kränken Sie mich!“
„Kannst du leugnen, auf uns geschossen zu haben?“
„Nein. Aber ich habe nicht gewußt, daß es Menschen sind!“
„Was denn? Für was hast du uns gehalten?“
„Nur für Affen.“
Anderswo hätte diese Ausrede auch anders geklungen als hier. Es gibt am Uruguay in Wirklichkeit Affen; ja dieselben sind dort zahlreich anzutreffen.
„Für Affen!“ meinte der Bruder. „Menschen für Affen zu halten, so eine Dummheit traue ich dir gar nicht zu.“
„Der Mondschein trügt. Ich glaubte, eine Affenherde zu sehen. Sie saßen so beisammen, wie Affen zu tun pflegen.“
„So hat sich die Schärfe deiner Augen gegen früher sehr verschlechtert. Nimm dich in Zukunft in acht, abermals Menschen für Affen zu halten!“
Der Bruder hatte diese Mahnung in erhobenem Ton gesprochen. Darum sagte der Indianer rasch:
„Pst, Bruder, nicht so laut, nicht so laut!“
„Warum?“
„Weil es gefährlich ist, des Nachts am Fluß laut zu reden.“
„Sind Menschen da?“
„Nein. Aber seit einigen Tagen schleicht sich ein Jaguar mit seinem Weibchen hier herum. Ich weiß schon, er geht auf Menschenfleisch; aber wir fürchten uns nicht. Petro und Daya sind klüger als der Jaguar.“
„Auch ich fürchte ihn nicht!“
„Ich weiß es. Kein Jaguar tut Ihnen ein Leid; aber auf Ihre Begleiter hat er nicht Rücksicht zu nehmen. Darum wollen wir leise sprechen, um ihn nicht herbeizurufen.“
Der Indianer war ein schlauer Patron. Er hielt es mit den Bolamännern und hegte doch auch Freundschaft für den Bruder. Er wollte die eine Partei der andern nicht verraten und erfand also das Märchen vom Jaguar.
„Er mag kommen mitsamt seinem Weib!“ sagte der Bruder. „Wir fürchten beide nicht. Dennoch hast du recht. Es ist nicht nötig, daß wir allzu laut reden. Setz dich! Ich habe dich zu fragen.“
Der Indianer gehorchte nur widerstrebend. Er sagte:
„Wollen wir uns nicht anderswo setzen, Bruder. Hierher könnte leicht der Jaguar kommen.“
Er wollte uns fortlocken, um uns vor den Bolamännern zu retten, ohne uns von ihnen sagen zu müssen.
„Nein, wir bleiben hier“, erklärte der Bruder.
„Aber ich weiß einen andern und viel bessern Platz!“
„Dieser hier gefällt uns ausgezeichnet. Woher kommst du?“
„Von der Jagd.“
„Das kann ich nicht glauben. Du hast ja keine Beute. Das wäre zum ersten Mal in deinem Leben, daß du kein Fleisch nach Hause brächtest.“
„Habe es da drüben niedergelegt, wo ich glaubte, auf Affen zu schießen.“
„So! Aber dann bist du sehr spät ausgegangen, denn Daya –“
Der gute Bruder mochte ein ganz vorzüglicher Klostermann sein; als einen Juristen, einen Untersuchungsrichter erwies er sich aber nicht, wenigstens jetzt nicht. Er schenkte dem Indianer zuviel Glauben. Petro Aynas meinte es zwar nicht böse mit uns, davon war ich überzeugt; aber er wollte unsere Gegner nicht verraten und suchte infolgedessen, uns zu täuschen. Mit dem Bruder und den andern wäre ihm dies wohl gelungen, denn der fromme Herr legte ihm die Antworten geradezu in den Mund oder vielmehr er gab ihm Fragen, aus denen Petro ersehen konnte, wie die Sache stand. Dem schlauen Menschen mußte man anders kommen. Darum ergriff ich den Bruder, noch bevor er ausgesprochen hatte, beim Arm und sagte:
„Mit Erlaubnis! Nicht solche Fragen. Lassen Sie lieber mich mit ihm reden!“
„Ganz gern! Ich höre zu.“
„Nein. Der Bruder mag mit mir reden, kein Fremder!“ sagte der Indianer, indem er mich mit einem ängstlichen Blick streifte.
Er saß so, daß ihm der Mond in das Gesicht schien. Dasselbe war nicht so schmutzig wie dasjenige seines Weibes, auch nicht so abstoßend. Er war überhaupt in
Weitere Kostenlose Bücher