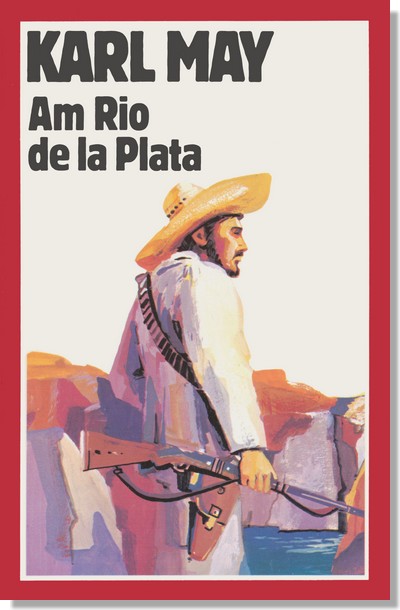![34 - Sendador 01 - Am Rio de la Plata]()
34 - Sendador 01 - Am Rio de la Plata
wohin Sie gehen.“
Das Anerbieten war mir nicht unwillkommen. Auf dem Rancho wohnte und schlief es sich jedenfalls besser, als hier am Flußufer. Dort konnten wir auch des Schadens, den wir doch vom Wasser davongetragen hatten, leichter Herr werden. Ich stellte also meinen Gefährten die Sache vor, und sie zeigten sich gern bereit, auf das Anerbieten des Indianers einzugehen.
Vom Kapitän erfuhren wir, daß das Schiff vor übermorgen mittag nicht zu erwarten sei, also konnten wir bis früh auf dem Rancho bleiben, ohne zu befürchten, die Fahrgelegenheit zu versäumen. Wir sagten denen, die uns fragten, daß wir lieber landeinwärts nach einem Unterkommen suchen wollten, und standen eben im Begriff, uns auf den Weg zu machen, als der Offizier mich um einige Worte bat.
Er hatte sich bereits dafür bedankt, daß ich seine Brieftasche trocken an das Ufer gebracht hatte, und sagte jetzt:
„Ich höre, daß Sie ein Fremder sind, Señor. Darf ich fragen, welchen Reisezweck Sie verfolgen?“
„Ich möchte den Gran Chaco kennenlernen“, antwortete ich.
„Das ist eine eigentümliche und fast gefährliche Aufgabe, welche Sie sich gestellt haben, Señor. Sind sie vielleicht Naturforscher?“
„Ja“, antwortete ich, um ihn zu überzeugen, daß ich keine landesgefährlichen Absichten verfolge.
„Beschäftigen Sie sich auch mit Politik?“
„Nein. Dieses Feld liegt mir so fern wie möglich.“
„Das freut mich, und so will ich Sie denn auch fragen, ob Sie für sich ein festes Unterkommen wissen oder nur ins Ungewisse hineinwandern wollen?“
„Ich soll nach einem Rancho geführt werden. Wir halten das geheim, damit nicht alle anderen nachgelaufen kommen.“
„Würden Sie mich und meinen Neger mitnehmen? Ich habe dringende Gründe, mich hier nicht zu verweilen.“
„Sehr gern. Sie sind uns willkommen.“
So schloß er sich uns also an, und der Indianer hatte nichts dagegen. Ob zehn oder zwölf auf dem Rancho ankamen, das war wohl gleichgültig. Nur sollten nicht so viele Leute mitgebracht werden, welche essen und trinken wollten, ohne bezahlen zu können oder bezahlen zu mögen.
Ich wollte die Indianerin, welche natürlich auch mitging, in den Sattel setzen; sie ging aber nicht darauf ein. Sie erklärte, sich plötzlich ganz gesund zu fühlen. Da es lächerlich ausgesehen hätte, wenn ich geritten wäre, während die anderen liefen, so ging ich auch und wies die Gesellschaft an, ihre Habseligkeiten auf das Pferd zu packen.
Das Ufer stieg, wie bereits gesagt, an der Stelle, an welcher wir uns befanden, langsam an, bis es die Höhe der Barranca erreichte. Das Gebüsch, welches wir zu durchschreiten hatten, war nicht dicht. Hohe Mimosen standen in demselben zerstreut. Zuweilen gab es eine Sumpflache, die wir umgehen konnten, sonst aber bot uns der Weg gegen unser Erwarten gar keine Schwierigkeiten. Der Grund davon war, daß der Indianer die Gegend sehr genau kannte. Er sagte, daß es genug undurchdringliche Dickichte und weit in das Land dringende Lagunen gebe, die er aber zu vermeiden wisse.
Später verlor sich das Gebüsch und wir gingen durch einen lichten Mimosenwald. Die Bäume standen weit auseinander. Sie werden hier wohl nur höchst selten über zehn Meter hoch, bilden aber wegen der sich an ihnen bis zur Spitze emporrankenden und blühenden Schlingpflanzen einen allerliebsten Anblick.
Der Sturm hatte sich fast völlig gelegt, und die Sonne kam wieder zum Vorschein. Es war einer jener Pamperos gewesen, die nur kurze Zeit anhalten, aber dafür eine zehnfache Stärke enthalten. Hier im Wald bemerkten wir von dem Wind fast gar nichts mehr.
Ich hatte mich unterwegs mit Bruder Hilario unterhalten. Der Offizier war nebenher gegangen und hatte unserem Gespräch wohl zugehört, sich aber nicht daran beteiligt. Erst als der Frater eine Bemerkung fallen ließ und ganz zufälligerweise den Namen des Major Cadera erwähnte, fragte der Offizier schnell:
„Cadera? Kennen Sie diesen Menschen?“
„Ja“, antwortete ich, „falls Sie nämlich denselben meinen, von welchem auch wir sprechen.“
„Es muß derselbe sein, denn es gibt nur einen einzigen Major Cadera. Sind Sie Freunde oder Feinde von ihm?“
„Hm! Das ist eine Frage, welche sich nicht so ohne weiteres beantworten läßt.“
„O doch. Wer nicht mein Freund ist, der muß doch mein Feind sein!“
„Wohl nicht. Es gibt Menschen, welche uns sehr gleichgültig sind, und das ist mir Cadera jetzt.“
„Früher war er es also nicht. So ist er
Weitere Kostenlose Bücher