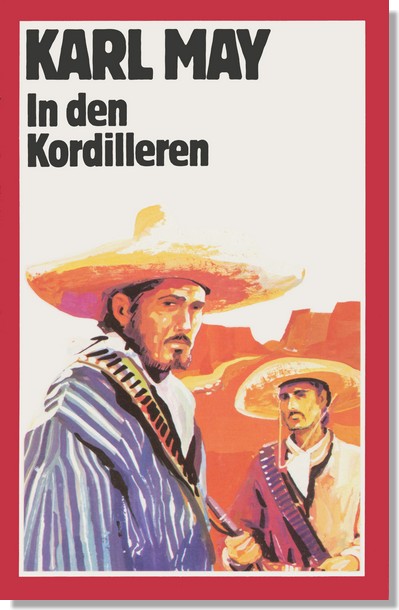![35 - Sendador 02 - In den Kordilleren]()
35 - Sendador 02 - In den Kordilleren
Staffage, welche ich im Vordergrund links des Bildes bemerkte. Dort lag nämlich ein Indianer auf dem saftigen Rasen, welcher infolge der großen und immerwährenden Feuchtigkeit üppig grünte, neben sich ein abgehäutetes Tier, ein Lama oder Guanako, das konnte man nicht so schnell entscheiden.
Der Mann kehrte uns den Rücken zu. Er hatte den linken Ellbogen in das Gras gestützt und den Kopf auf die Hand gelegt. Am Felsen unweit des Wasserlochs, fünf oder sechs Schritte von ihm entfernt, lehnte sein Gewehr.
„Wahrhaftig. Sie haben die Spur ganz richtig gelesen!“ sagte Pena. „Es ist genauso, wie Sie vermuteten.“
Während dieser Worte trieb er sein Pferd zurück, um ebenso wie ich wieder in der Schlucht zu verschwinden.
„Ein unvorsichtiger Patron! Der Mann scheint zu träumen, und noch dazu das Gewehr so weit weg an der Wand.“
„Was tun wir mit ihm?“ fragte Pena.
„Festnehmen natürlich.“
„Wer macht's? Sie oder ich?“
„Ich. Halten Sie mein Pferd, und kommen Sie, wenn ich winke!“
Ich stieg vom Pferd und trat wieder aus der Schlucht heraus. Der Rasen war so weich, daß mein Schritt selbst dann, wenn es den Wasserfall nicht gegeben hätte, nicht gehört worden wäre. Ich eilte nach links hinüber an die Felswand und an derselben hin bis zu dem Gewehr. Es war, als wisse ich ganz genau, daß er sich nicht umdrehen werde. Darum nahm ich die Flinte in die Hand und zog den Hahn halb auf. Es war kein Zündhütchen aufgesetzt. Der alte Schießkolben konnte jetzt also weder mir noch einem anderen gefährlich werden. Ich stellte ihn beiseite und trat zu dem Mann. Ich beugte mich über ihn, um sein Gesicht zu sehen. Auch das bemerkte er nicht, denn er hatte die Augen geschlossen, wahrscheinlich weil er ermüdet war. Er schien etwa fünfzig Jahre alt zu sein, trug leichte Kleidung, einen breitkrempigen Strohhut und einen alten Gürtel, in welchem ein Messer steckte.
Jetzt kniete ich hinter ihm nieder, griff mit der Linken nach seinem Hals, drückte ihm den Kopf auf die Erde, zog mit der Rechten sein Messer aus dem Gürtel und stemmte ihm dann das rechte Knie quer über die Beine.
Das geschah natürlich sehr schnell. Ich hatte ihn schon fast unter mir, als er die Augen öffnete und mich entsetzt anstarrte. An der Bewegung seiner Lippen ersah ich, daß er schrie; hören konnte ich es wegen des Geräusches des Wasserfalls nicht.
Ich war auf Gegenwehr vorbereitet gewesen; er aber schien gar nicht an so etwas zu denken, denn er blieb unter mir liegen, ohne eine Bewegung, einen Versuch zu machen, von mir loszukommen. Darum stand ich auf, hielt ihn am Hals fest, ergriff ihn bei der Brust und führte ihn fort, vom Wasser weg und in die Schlucht hinein, wo Pena hielt. Er ging mit, ganz wie einer, welcher seiner Sinne nicht mehr mächtig ist. Da, wo wir uns nun befanden, konnte man gesprochene Worte verstehen.
„Das ging schnell und leicht“, meinte Pena in deutscher Sprache. „Der Mann scheint ganz perplex zu sein.“
„Vor Entsetzen. Sehen Sie seinen Blick. Er zittert. Das ist nicht gewöhnliche Furcht oder Angst, sondern geradezu Entsetzen.“
„Ist's ein Chiriguano?“
„Das werden wir ja gleich erfahren. Fragen Sie ihn! Sie sind mir in dem Indianerdialekt über.“
„Vielleicht versteht er Spanisch.“
„Wahrscheinlich, denn wer zum Fleischmachen ausgesendet wird, der trifft leicht mit Leuten zusammen, mit denen er sprechen können muß; darum ist allerdings zu erwarten, daß dieser Mann der Landessprache wenigstens einigermaßen mächtig ist.“
„So reden Sie ihn vorerst an. Kann er Ihnen nicht antworten, dann werde ich es versuchen.“
Ich konnte dieser Aufforderung nicht sofort Folge leisten, da soeben unsere Gefährten herbeikamen und uns einholten. Sie machten, als sie den Roten in meinen Händen sahen, Gesichter, welche keineswegs freundlich waren, was seine Angst bedeutend vergrößerte. Als er sah, daß sie ihre Pferde verließen und ihn und mich drohend umringten, rief er in spanischer Sprache, deren er also doch mächtig war, aus:
„Señor, warum überfallen Sie mich? Warum lassen Sie mich nicht los? Ich habe Ihnen doch nichts getan!“
„Bis jetzt noch nicht!“ antwortete ich ihm. „Und es wird sich sogleich finden, ob wir dich als Freund oder Feind zu behandeln haben. Zu welchem Stamm gehörst du? Bist du ein Toba oder ein Chiriguano?“
„Ich bin ein Aymara und lebe mit den Weißen in Frieden.“
„Mit wem befindest du dich hier?“
„Mit
Weitere Kostenlose Bücher