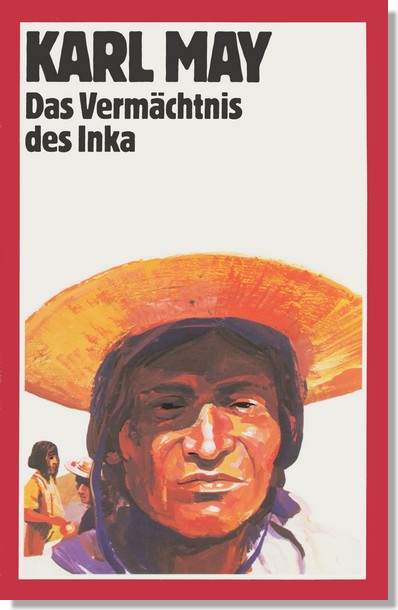![36 - Das Vermächtnis des Inka]()
36 - Das Vermächtnis des Inka
Vertrauen zu dessen Tüchtigkeit, daß es ihm gar nicht beikam, Angst um ihn zu haben. Nach dieser Zeit tauchte der Inka wieder aus dem Dunkel auf und meldete mit leiser Stimme: „Es war kein einziger Wächter da. Die Pferde waren alle so zutraulich, daß sie sich von mir streicheln ließen. Sie gingen frei im Gras, und nur der Madrina sind die Vorderbeine leicht gefesselt, damit sie keine weiten Schritte machen kann.“
„Wie viel Pferde waren es?“
„Ich konnte sie natürlich nicht zählen, ich merkte aber, daß es nicht wenige sind. Ich fand sie alle mit den Köpfen nach der Madrina gerichtet und habe mich sehr darüber gefreut.“
„Warum?“
„Weil dies ein Zeichen ist, daß sie ihr unbedingt folgen werden.“
„Und darüber freust du dich?“
„Ja, denn wenn es etwa feindliche Indianer, also Aripones sind, so möchte ich ihnen ihre Pferde nehmen.“
„Ist das dein Ernst? So viele Tiere können wir zwei unmöglich fortbringen!“
„Warum nicht? Wenn wir die Madrina mit uns führen, laufen die anderen alle hinterdrein.“
„Aber die Indianer würden am Klang der Glocken hören, daß die Stute sich entfernt!“
„Wenn man schläft, hört man das nicht, und du gibst doch wohl zu, daß diese Leute schlafen werden?“
„Ja; aber Wachen haben sie jedenfalls ausgestellt.“
„Allerdings; aber da sie, wie ich vermute, sich hier so sicher fühlen, werden die Wächter nicht zahlreich sein. Wir werden das gleich zu erfahren suchen. Komm und halte dich stets hinter mir! Wir dürfen nicht mehr gehen, sondern müssen kriechen, damit wir nicht bemerkt werden.“
Sie legten sich auf die Erde nieder und bewegten sich nun mit äußerster Vorsicht von ihrer bisherigen Richtung ab nach links hinüber, um unter die erwähnten Bäume zu gelangen. Als sie dieselben erreicht hatten, befanden sie sich zugleich ganz nahe dem Rand der offenen Waldlücke, in welcher der Inka das Lager vermutet hatte. Diese Lücke war nicht breit, und die Feuer leuchteten von einem Ende derselben bis zum anderen. Man sah also genau, was dort vorging. Die beiden Jünglinge lagen hinter zwei nahe beieinander stehenden Bäumen und beobachteten mit scharfen Augen, was da vor ihnen vorging.
Es war eine sehr zahlreiche Schar von Indianern, welche ihr Nachtlager aufgeschlagen hatte. Da, wo die Lichtung sich gegen das freie Land öffnete, drang die Quelle aus dem Boden, um ihr Wasser links nach dem See zu schicken. Zu beiden Seiten dieses Wasserlaufes brannten acht Feuer, um welche sich wohl gegen achtzig Rote bewegten, denn sie waren soeben beschäftigt, sich die bequemsten Stellen zum Schlafen zu suchen. Zwischen zwei Feuern, welche diesseits des Wassers brannten, lagen sechs Gestalten, welche gefesselt zu sein schienen. Fünf von ihnen waren wie Indianer gekleidet; den sechsten konnte man seinem Anzug nach für einen Weißen halten. Da sie mit den Köpfen nach den zwei heimlichen Beobachtern zu lagen, war es diesen unmöglich, die Gesichter zu sehen.
Diese Schar war indianisch bewaffnet. Sie hatte an den in der Erde steckenden langen Lanzen ihre Köcher und Bogen aufgehängt. Daneben lehnten die Blasrohre, deren kleine Geschosse, wenn sie vergiftet sind, so schnell tödlich wirken. Drüben stand unter einem Baum der einzige, welcher ein Gewehr besaß; er hatte es neben sich auf seinem Poncho liegen und schien der Häuptling zu sein, denn er erteilte soeben verschiedene Weisungen, denen sofort nachgekommen wurde. Er bediente sich dabei einer Sprache, welche einen singenden Tonfall hatte. Anton verstand kein Wort davon und fragte darum seinen Gefährten leise: „Das ist nicht Ketschua und auch nichts anderes, was ich verstehe. Welche Sprache redet der Mann?“
„Es ist Ariponisch; ich verstehe es ziemlich. Er ist der Anführer dieser Leute, er sagt ihnen, wie sie lagern sollen, und hat soeben befohlen, daß die Nacht in drei Wachen geteilt wird. Jede dieser Wachen betrifft nur zwei Personen, von denen die eine den Pferden und die andere den Gefangenen ihre Aufmerksamkeit zu schenken hat.“
„Also doch Gefangene! Wer mögen sie sein?“
„Warte nur! Wahrscheinlich erfahren wir es noch. Ich kenne den Häuptling nicht, habe ihn noch nie gesehen, aber seiner Sprache nach gehört er mit seinen Leuten den Aripones, also unseren Feinden an.“
„Daraus können wir schließen, daß die Gefangenen Freunde von uns sind.“
„Ja, denn wer gegen sie ist, der muß für uns sein.“
„Wenn wir sie befreien könnten! Denkst du, daß
Weitere Kostenlose Bücher
![Die vierte Zeugin]()
Die vierte Zeugin Online Lesen
von
Tanja u.a. Kinkel
,
Oliver Pötzsch
,
Martina André
,
Peter Prange
,
Titus Müller
,
Heike Koschyk
,
Lena Falkenhagen
,
Alf Leue
,
Caren Benedikt
,
Ulf Schiewe
,
Marlene Klaus
,
Katrin Burseg