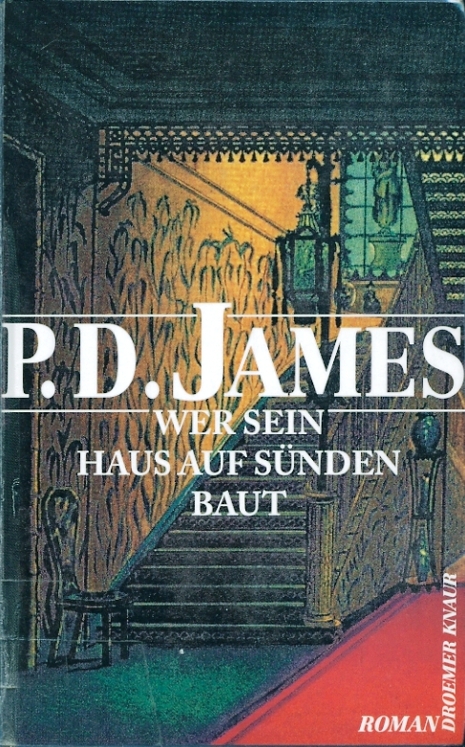![Adam Dalgliesh 09: Wer sein Haus auf Sünden baut]()
Adam Dalgliesh 09: Wer sein Haus auf Sünden baut
gesprochen, aber ich glaube, er hat mir zugenickt und gelächelt. Ein flüchtiger Gruß im Vorbeigehen, mehr nicht. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich ging zurück in meine Wohnung, und die nächsten zwei Stunden verbrachte ich damit, die Gedichte, die ich für die Veranstaltung am Abend ausgewählt hatte, noch einmal zu lesen und zu überdenken. Zwischendurch kochte ich Kaffee und hörte die Sechs-Uhr-Nachrichten der BBC. Kurz danach rief mich Frances Peverell an und wünschte mir Glück für die Lesung. Sie hatte sich angeboten, mitzugehen. Ich glaube, sie fand, es sollte jemand vom Verlag dabeisein. Aber es gelang mir, sie davon abzubringen. Zu der Lesung war nämlich unter anderem auch Marigold Riley eingeladen. Sie ist keine schlechte Lyrikerin, hat aber eine fatale Vorliebe für Fäkalausdrücke. Ich wußte, daß Frances weder die Gedichte noch die Gesellschaft oder die Atmosphäre dort zusagen würden. Also hab’ ich ihr gesagt, daß ich lieber allein gehen und daß ihre Gegenwart mich nur nervös machen würde. Das war nicht ganz gelogen. Ich hatte seit fünfzehn Jahren nicht mehr aus meinen Werken vorgelesen. Die meisten Zuhörer auf dieser Veranstaltung würden mich vermutlich längst für tot halten. Ich wünschte mir ohnehin schon, daß ich die Einladung abgelehnt hätte. Wenn ich auch noch Frances dabeigehabt und mir dauernd Sorgen gemacht hätte, ob sie wohl arg schockiert und wie sehr ihr das alles zuwider sein mochte, dann wäre das Trauma nur noch größer geworden. Um es kurz zu machen: Ich bestellte mir telefonisch ein Taxi und verließ kurz nach halb acht das Haus.«
»Könnten Sie ›kurz nach halb‹ präzisieren?« fragte Dalgliesh.
»Ich hatte das Taxi für Viertel vor acht bestellt, und ich nehme an, ich habe es ein paar Minuten warten lassen, aber bestimmt nicht länger.« Er zögerte wieder und fuhr dann fort: »Was im Connaught Arms passierte, wird Sie kaum interessieren. Jedenfalls sind genügend Leute dagewesen, die bestätigen können, daß ich dort war. Ich glaube, die Lesung verlief besser, als ich erwartet hatte, aber der Vortragsraum war überfüllt, und die Leute machten schrecklich viel Krach. Ich hatte gar nicht mitbekommen, daß Dichtung inzwischen zum Volkssport geworden ist. Es wurde eine Menge getrunken und geraucht, und einige der Vortragenden waren ziemlich ausschweifend, was die Veranstaltung furchtbar in die Länge zog. Ich wollte den Wirt eigentlich bitten, mir ein Taxi zu rufen, aber der war von einem ganzen Schwarm Leute umlagert, und so habe ich mich mehr oder weniger unbemerkt verdrückt. Ich dachte, ich würde an der nächsten Ecke schon ein Taxi finden, doch bevor ich soweit kam, wurde ich überfallen. Sie waren, glaube ich, zu dritt, zwei Schwarze und ein Weißer, aber ich würde sie wohl kaum wiedererkennen. Ich habe nur gehört, wie jemand hinter mir hergerannt kam, dann spürte ich einen kräftigen Stoß in den Rücken und Hände, die meine Taschen durchwühlten. Dabei hätten sie gar keine Gewalt anzuwenden brauchen. Ich hätte ihnen meine Brieftasche sogar freiwillig gegeben. Was wär’ mir denn auch anderes übriggeblieben?«
»Ihre Brieftasche haben sie also mitgehen lassen?«
»Allerdings. Zumindest war sie weg, als ich nachschaute. Der Sturz hatte mich einen Moment lang ganz benommen gemacht.
Als ich wieder zu mir kam, beugten sich ein Mann und eine Frau über mich. Sie waren auch bei der Lesung gewesen und mir nachgelaufen, weil die Frau ein Autogramm wollte. Ich war bei dem Sturz mit dem Kopf aufgeschlagen, und da es ein bißchen blutete, preßte ich ein Taschentuch auf die Wunde und bat die beiden, mich heimzubringen. Aber sie sagten, sie müßten sowieso am St.-Thomas-Krankenhaus vorbei und bestanden darauf, mich dort abzusetzen. Sie meinten, ich müsse mich unbedingt röntgen lassen. Ich konnte natürlich nicht verlangen, daß sie mich nach Hause fuhren oder mir ein Taxi besorgten. Sie waren schon sehr hilfsbereit, aber ich glaube, allzu große Umstände wollten sie sich auch nicht machen. Im Krankenhaus mußte ich ziemlich lange warten. Auf der Unfallstation waren dringendere Fälle zu behandeln. Schließlich kam aber doch eine Schwester, versorgte die Kopfwunde und meinte, ich müsse noch geröntgt werden. In der Röntgenabteilung ging die Warterei natürlich von vorne los. Das Ergebnis war zufriedenstellend, ich hatte keinerlei ernsthafte Verletzungen davongetragen, aber man wollte mich die Nacht über zur Beobachtung dabehalten.
Weitere Kostenlose Bücher