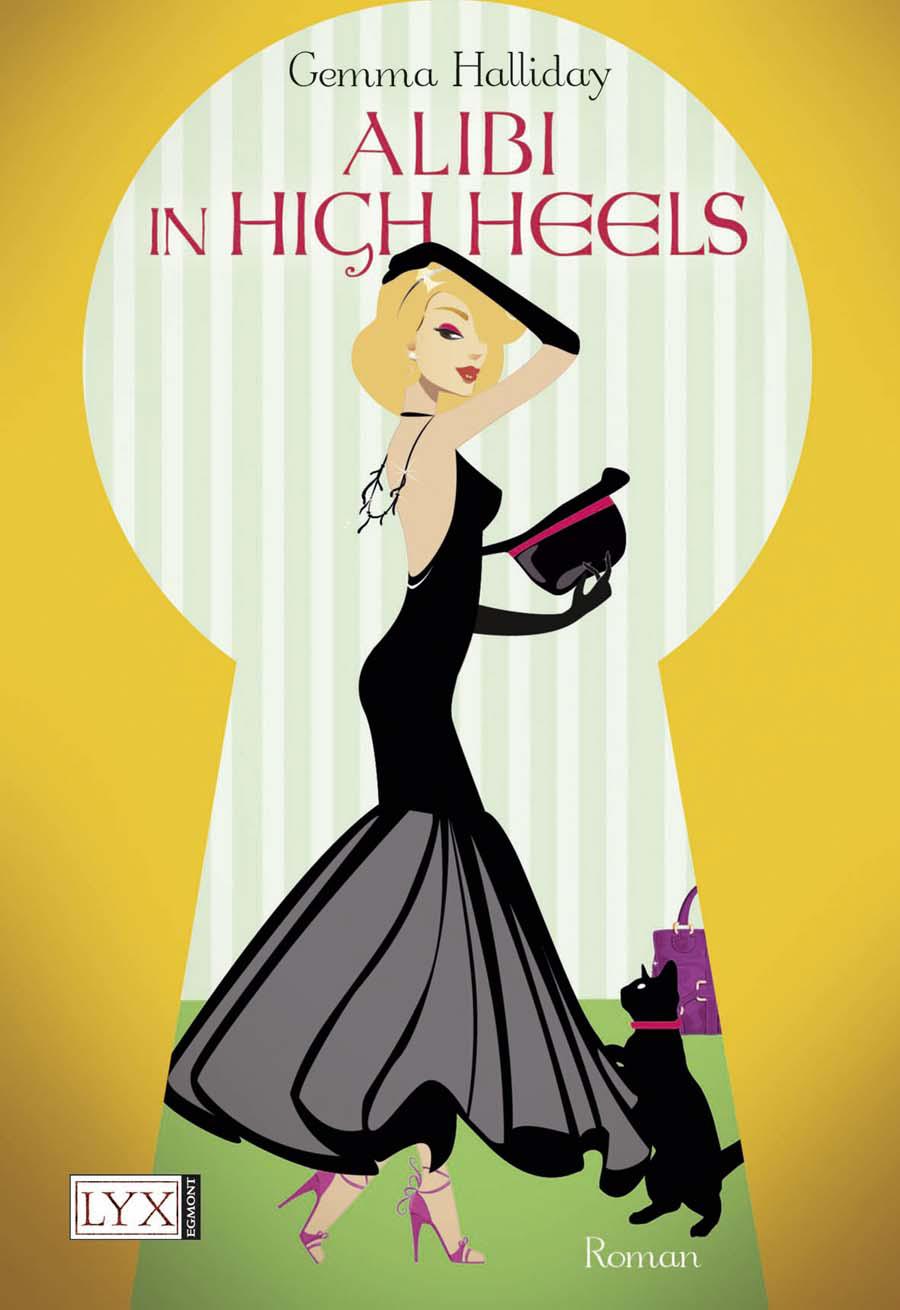![Alibi in High Heels (German Edition)]()
Alibi in High Heels (German Edition)
glaube, sie wird ihm gleich den Hintern versohlen.«
Ich hatte die Worte noch nicht ganz ausgesprochen, da fuhr das Paddel herunter und man hörte ein Klatschen. Die Menge brach in Jubel aus, als hätte die Lederlady gerade einen Touchdown erzielt.
Ich bedeckte meine Augen.
Gut, ich gebe zu, ich bin selbst kein Kind von Traurigkeit. Aber Peitschen und Ketten, das war weit außerhalb meiner Komfortzone. (Und wenn ich sage weit, dann meine ich Lichtjahre.)
Dana dagegen hatte eine sehr ausgedehnte Komfortzone.
»Oh, das muss ich mir ansehen«, sagte sie und marschierte los.
»Warte, Dana«, protestierte ich, doch es war zu spät, sie zwängte sich bereits durch die Menge nach vorn. Nun hatte ich zwei Möglichkeiten: Allein hier stehen zu bleiben oder ihr zu folgen. Ich blickte nach rechts. Ein Typ, der außer schwarzen Lederbikershorts nur sehr wenig am Leibe trug, machte mir schöne Augen.
»Warte auf mich!«
Ich drängte mich vorwärts und schlug nur drei Leuten meine Krücken vor das Schienbein, bis ich endlich zu ihr vorgedrungen war. Um die Bühne war ein langes Geländer errichtet worden, auf das Dana sich jetzt mit den Ellbogen stützte, während sie mit glasigen Augen zusah, wie die Lederlady Slave Boy bearbeitete.
»Er ist doch irgendwie süß, oder?«, fragte sie und zeigte auf den Sklaven.
Eine Frage, die ich ihr nicht beantworten konnte, denn ich hielt immer noch die Hand vor die Augen. Vorsichtig spähte ich zwischen Ringfinger und kleinem Finger hindurch. Und selbstverständlich suchte sich die Lederlady gerade diesen Moment aus, um Slave Boy seiner Lederhose zu entledigen. Ich spürte, wie ich bis unter die blonden Haarwurzeln errötete, als ich ungebeten einen Blick auf den splitterfasernackten Slave Boy erhaschte.
Ich fasste Danas Arm. »Oh mein Gott«, sagte ich.
Dana fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Ich weiß. Gott, ich vermisse Ricky.«
»Nein.« Ich schüttelte den Kopf. Nicht, dass Slave Boy nicht ein beeindruckendes … äh, Gemächt gehabt hätte. Aber der Grund, warum ich Danas Arm so fest umklammerte, war der, dass ich dieses Gemächt wiedererkannte. Es war dasselbe wie das, was ich auf dem Display von Gisellas Kamera gesehen hatte.
Slave Boy war Ryan Jeffries.
Ich ließ Dana im ersten Stock zurück, damit sie sich den Rest von Ryans Auftritt ansehen konnte, und strebte zur Bar wie ein Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Vermutlich würden neunzig Prozent der Gäste des Club X heute mit blauen Flecken am Schienbein nach Hause gehen. Zum x-ten Mal murmelte ich »’tschuldigung«, als ich einer Frau in sieben Zentimeter hohen Stiletto-Pumps, einem Fischnetz und einem schwarzen Mieder einen Schlag versetzte, und ließ mich auf ein rotes Samtsofa sinken, um auf Dana zu warten. Fünfzehn Minuten später erschien sie endlich, mit glänzenden Augen, fast als wäre sie high, Ryan im Arm. Dankbar stellte ich fest, dass er die Lederhose wieder angezogen hatte, dennoch errötete ich erneut, als er und Dana sich links und rechts neben mir niederließen.
»Maddie, du hast eine tolle Show verpasst«, sagte Dana.
»Davon bin ich überzeugt«, murmelte ich, Augenkontakt mit Ryan vermeidend.
»Ryan, das ist Maddie, von der ich dir erzählt habe.«
»Hallo«, sagte er. Dann legte er den Kopf auf die Seite. »Sag mal, kennen wir uns von irgendwo her?«
Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich war mir ziemlich sicher, dass ich mich an einen Mann wie diesen erinnert hätte.
Er war groß, mindestens ein Meter achtzig, hatte hellblondes Haar und hellblaue Augen. Jetzt, da er mehr oder weniger in senkrechter Haltung war, sah man auch, dass er den schlanken, muskulösen Körper eines Models hatte. Ich konnte mir gut vorstellen, wie er in Calvin-Klein-Klamotten über den Laufsteg schritt. Sein Alter schätzte ich auf Ende zwanzig, Anfang dreißig, vielleicht schon ein wenig zu alt für den Laufsteg – was seine jetzige Beschäftigung erklären würde.
»Bist du sicher?«, fragte er. »Du kommst mir so bekannt vor.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein.«
Dann dämmerte die Erkenntnis in seinen blauen Augen. »Warte, du bist die Designerin, die Gisella erstochen hat!«
»Ich habe sie nicht erstochen. Ich schwöre es. Das ist eine Erfindung der Presse.«
Er sah mich argwöhnisch an.
»Ich würde nie jemandem wehtun!« Mein Blick fiel auf sein Halsband. »Äh, ich meine, nicht dass es per se schlecht wäre, jemandem wehzutun. Wenn man will, dass einem wehgetan wird. Was du ganz
Weitere Kostenlose Bücher