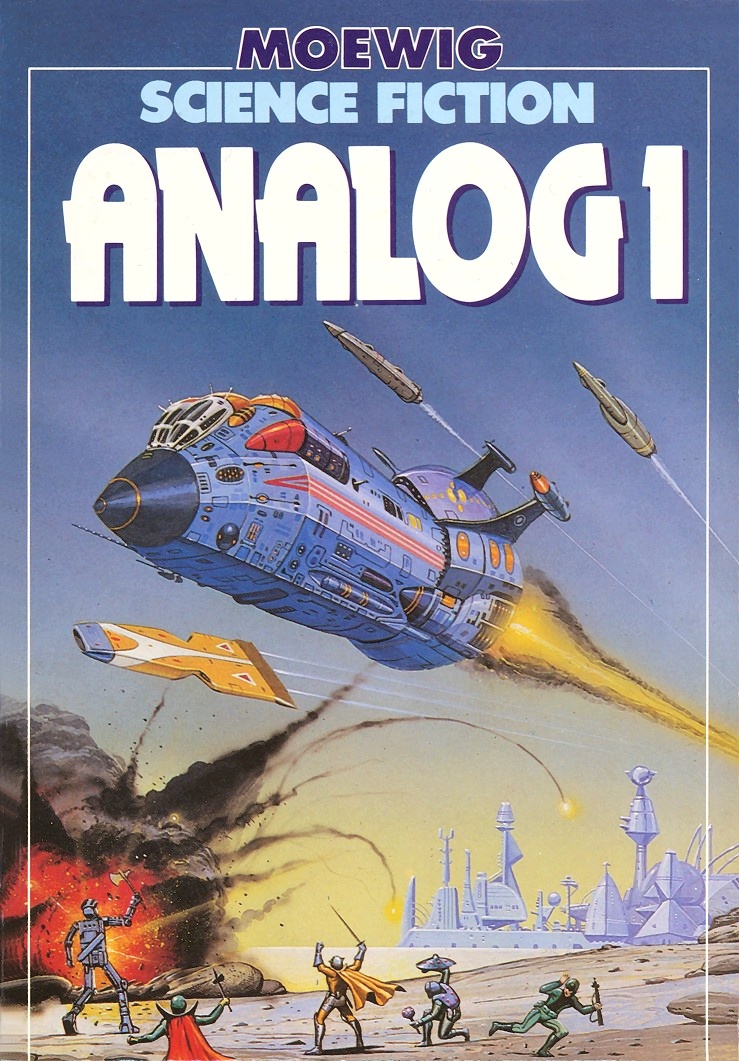![Analog 1]()
Analog 1
Spinnen laufen bereits über die Weben in das Glasgefäß.“
„Ich sehe keine“, sagte der Pförtner zweifelnd.
„Nun, natürlich nicht. Sie sind unsichtbar. Ich erklärte das vor hin schon.“ Er rief eine kurze Frage zu Morissey hinüber. „Wie sieht’s aus, Bob? Kommen immer noch welche?“
„Da kommt noch eine. Das Glas ist fast voll. So, ich hab’ sie. Ganz schöne Menge!“ Er versperrte das Glas mit einem Deckel. „Seht ihr!“ Er ging auf den Pförtner zu, der einen Schritt zurückwich.
„Sehen Sie?“ fragte Morissey wieder und hielt das Glas hoch.
„Nein, Doc, ich sehe nichts. Ist aber schon in Ordnung.“
„Wenn man sie richtig gegen das Licht hält, kann man sie erkennen“, erläuterte Quentin Thomas. „Sehen Sie … hier … und hier …!“
„Ja, schätze schon. Sind jetzt alle verschwunden?“
„Jede einzelne. Dafür garantieren wir. Sie können dem Mähkommando sagen, es ist nun vollkommen gefahrlos, die Weben zu beseitigen. Kein Risiko mehr. Im Gebäude selbst sieht die Sache natürlich anders aus. Dafür übernehmen wir keine Verantwortung.“
„Schon gut.“
„Bitte unterschreiben Sie hier“, bat Quentin Thomas. Er reichte dem Pförtner ein Formular.
„Was ist das?“
„Eine Quittung. Sie bestätigen damit, daß wir hier waren und Ihren Rasen von Ungeziefer befreit haben. Ich brauche das, damit die Verwaltung die Rechnung ausstellen kann. Da bei dem ‚X’. Hier ist ein Kugelschreiber.“
„Nun, okay. Aber ich glaube nicht, daß ich dazu autorisiert bin.“
„Spielt keine Rolle. Schönen Tag noch. Oder Nacht.“
Der Pförtner sah auf die Uhr. Es war drei Uhr morgens. „Egal“, sagte er. Da klingelte das Telefon. Er ging zum Pförtnerhäuschen.
„Das ist womöglich Kull“, flüsterte Quentin Thomas. „Verschwinden wir von hier.“
„Nichts lieber als das“, antwortete Morissey. „Wohin gehen wir?“
„Zu mir. Ich habe ausreichend Platz.“
Er dachte nach. Da war etwas mit den Weben, die auf dem Rasen ausgebreitet waren. Und mit Spinnen. Ein grundlegender, bedeutender Aspekt lag vor seinen Augen, und er konnte ihn nicht entdecken.
Verdammt.
Nun gut, nach Hause. Erst wollte er Robert Morissey versorgen. Vielleicht kam er dann auf die Lösung seines Problems.
Thomas ging in seinem Schlafzimmer auf und ab. Er konnte nicht schlafen. Nicht wegen Robert Morissey – nein, der Erfinder war wohlversorgt im Gästezimmer und sorgfältig vor der Außenwelt verborgen. Der Schöpfer von Faust hatte nichts mit Thomas’ gegenwärtigem Unbehagen zu tun.
Es war auch nicht nur Schlaflosigkeit, die ihn wachhielt. Er war vollkommen wach, als würde er am hellen Nachmittag die Hauptstraße hinabgehen. Er wußte auch, warum. Sein Unterbewußtsein sprach mit ihm. Aber er verstand nicht, was es ihm zu sagen hatte.
Er lauschte in die Dunkelheit hinein. Wonach? Nichts. Nirgendwo war ein Laut zu hören. Er sah auf die kleine Nachttischuhr. Sechs Uhr morgens. Es war eine lange Nacht gewesen. Auf dem Nachttisch lag außerdem ein alter Roman, den er vor einigen Tagen begonnen, aber bisher noch nicht beendet hatte: Hornblower and the Atropos von C.S. Forester. Er nahm das Buch abwägend in die Hand. Enthielt es einen Hinweis für ihn? Wenn ja, dann erkannte er ihn nicht … Er legte es fast zögernd wieder weg und ging in die Bibliothek. Was erwartete er hier zu finden? Seine Augen fanden eine leere Bandkassette. Beethovens Fünfte Symphonie. Eine neue Aufnahme mit der New Yorker Philharmonie. Sein Puls schlug rascher. In Gedanken lauschte er nochmals den vier eröffnenden Noten. Diesen gewaltigen, schmetternden Tönen. „Das Schicksal pocht an die Tür“, soll der große Komponist gesagt haben.
Ah … Schicksal …
Wir nähern uns der Sache, dachte er.
Er ging hinüber zum Regal mit den Notenblättern. Schubert … Schumann … Strauss … Da war es. Tschaikowski. Er holte das schmale Bändchen heraus und ging zum Flügel. Kindworths Arrangement der großartigen Vierten Symphonie für Klavier. Tschaikowskis Patronin, Nadejda von Meck, hatte diese Variation im September 1879 gespielt, wonach sie zwei Tage und Nächte bewußtlos gewesen war. Er massierte kurz seine Hände, um die Finger zu entspannen, dann begann er:
Ja. Das „Fatum“-Thema. Der unausweichliche Ruf des Schicksals. Das Blut konnte einem dabei in den Adern gefrieren.
Und was ist Schicksal? Das Fehlen eines freien Willens?
Er spielte weiter bis zum Andante . Nun, vielleicht. Aber er
Weitere Kostenlose Bücher