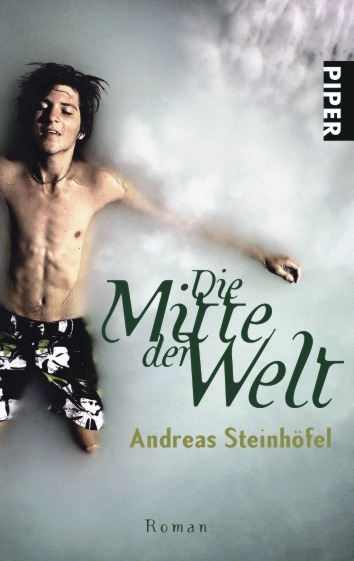![Andreas Steinhofel]()
Andreas Steinhofel
Mitmenschen entblößt; der nüchterne Sachverstand und die
Gelassenheit Terezas. Ich besitze nichts oder zu wenig von
alldem. Trotzdem löchere ich Nicholas weiter mit Fragen.
»Warst du lange im Internat?«
»Zu lange. Schon immer.«
»Warum haben deine Eltern…«
Er unterbricht mich, indem er eine Hand hebt. »Aus
demselben Grund, der die meisten Eltern ihre Kinder
abschieben lässt. Sie wollen ihre Ruhe haben. Ihrer Karriere
nachgehen. Sind überfordert, weil du dich nicht als das
Spielzeug entpuppt hast, als das du mal geplant warst.«
»Ich dachte, man landet im Internat, weil man zu schwierig
ist.«
»Irgendein Vorwand findet sich immer.«
»Welchen Vorwand gab es bei dir?«
»Wie ich schon sagte, irgendeiner.« Nicholas fährt sich mit
einer Hand durch die Haare. Jede seiner Bewegungen
elektrisiert mich. Seine Lippen haben diesen wunderbar
wellenförmigen, weichen Schwung, mit Konturen von solcher
Scharfkantigkeit, dass man sich beim Küssen daran verletzen
möchte. »Jedenfalls war ich so gut wie nie zu Hause. Oder in
der Stadt. Mann, diese tote Stadt…« Er schüttelt den Kopf und
sieht mich fragend an. »Wie hältst du das bloß aus?«
»Es gibt hier gutes Vanilleeis.«
»Und wie viel davon muss man essen, bevor man die Nase
endlich voll hat?«
Kat und ich haben tausendmal durchdacht, wie es sein wird,
der Stadt eines Tages den Rücken zu kehren. Nicholas hat das
schon längst getan. Dass äußere Umstände ihn dazu gezwungen
haben, macht seine Arroganz nicht weniger legitim. Jetzt wieder
hier abgeschrieben zu sein muss ihm als empfindlicher
Rückschritt vorkommen.
»Was machen deine Eltern?«
»My daddy’s rich, and my ma is good lookin’«, singt er leise.
Summertime, Gershwin. Dann grinst er mich an. »Du bist
Amerikaner, stimmt doch, oder? Du hast eine verrückte
Zwillingsschwester, die früher mit Pfeil und Bogen Jagd auf
kleine Jungs gemacht hat. Um die großen Jungs kümmert sich
deine Mutter, es sei denn, sie macht sich gerade um das
Seelenheil ihrer Mitbürgerinnen verdient.« Nicholas zeigt quer
über den Fluss in Richtung Visible. »Und ihr wohnt in diesem
riesigen alten Haus drüben am Wald.«
»Wer erzählt das?«
»Meine geschätzte Kollegin vom fest gezurrten Haupthaar,
Frau Hebeler. Und wahrscheinlich jeder sonst in der Stadt, den
du fragst.«
Er selbst hat keine Geschwister. Sein Vater ist der Leiter einer
Metall verarbeitenden großen Fabrik, irgendwo im Umland.
Seine Mutter sitzt den ganzen Tag zu Hause, wo sie wahlweise
trinkt oder Tabletten schluckt um nicht darüber nachdenken zu
müssen, warum das Schicksal ausgerechnet sie an die Gestade
der tiefsten Provinz gespült hat.
»Ein Klischee«, beendet Nicholas achselzuckend die kurze
Aufzählung und fügt abfällig hinzu: »Und ein ziemlich
peinliches obendrein.«
»Irgendwo müssen Klischees ja herkommen.« Über die Jahre
hinweg hat Glass Dutzende von Kundinnen wie seine Mutter
gehabt. Vielleicht ist seine Mutter eine ihrer Kundinnen. Aber
Glass danach zu fragen wäre müßig, sie würde es mir nicht
verraten. »Klingt jedenfalls nicht danach, als hättet ihr das beste
Verhältnis zueinander, du und deine Mutter.«
»Vielleicht ist das so.«
Und vielleicht gilt dasselbe für seinen Vater. Wenn es
Nicholas nur um irgendeinen Job ginge, könnte er nachmittags
sicher auch in dessen Fabrik arbeiten, an den Maschinen, im
Büro, in der Verwaltung.
»Ich hab dich schon mal gesehen, hier, in der Stadt«, sage ich,
nachdem eine endlose Minute lang kein Wort gefallen ist und
wir nur auf den Fluss gestarrt haben. »Ist schon eine Weile her.«
»Tatsächlich?«
»Vor fünf Jahren. Es war Winter. Du standest auf der Treppe
vor der Kirche.«
»Muss in den Weihnachtsferien gewesen sein. Ich kann mich
nicht erinnern.«
Er klingt nicht im Entferntesten interessiert. Ich habe mir
gewünscht, dass er sich an unsere erste Begegnung erinnert;
jetzt spüre ich einen Nadelstich der Enttäuschung. Und langsam
macht mich das Gefühl nervös, dass nur ich es bin, der Fragen
stellt und die Unterhaltung in Gang hält. Er ist ein Blender, höre
ich Kat sagen. Macht auf außen hart und innen sensibel. In
Wirklichkeit ist er außen weich und innen langweilig.
Vielleicht sollte ich weniger Fragen stellen und mehr in die
Offensive gehen, Taten statt Worte. Ich überlege, ob ich dem
Läufer einen Arm um die Schulter legen soll, und muss schon
den Ansatz einer entsprechenden Bewegung vollführt haben, die
er
Weitere Kostenlose Bücher