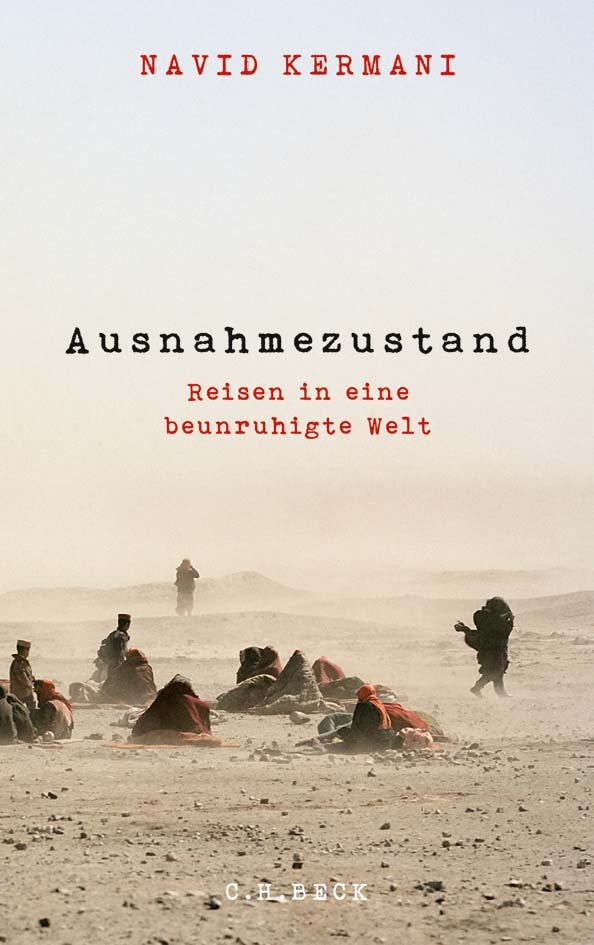![Ausnahmezustand]()
Ausnahmezustand
sieben begraben waren, nein, nicht hier auf dem Friedhof, sondern wo immer sich ein geschütztes Fleckchen Erde fand. Den Friedhof zu betreten traute sich in jenen Tagen niemand, Heckenschützen überall.
– Seitdem bin ich ganz allein, sagt Nur Agha und tätschelt sein Schaf, als wolle er die Einsamkeit nicht wahrhaben.
Als die Menschen ihre Toten wieder auf dem Friedhof begruben, baute er hier einen kleinen Teestand auf. Gute Lage, dachte er sich, schließlich herrschte immer noch Krieg. Ein Haus hatte er ja nicht mehr und keine Kraft, von vorn zu beginnen. Also blieb er auch nachts auf dem Friedhof, zwanzig Jahre ist das her. Ob es heute besser sei, frage ich, oder unter den Taliban?
– Natürlich ist es heute besser, antwortet Nur Agha.
Heute könnten wieder alle Menschen die Gräber ihrer Nächsten besuchen, auch die Frauen und die jungen Leute. Die Frauen hätten nicht aus der Stadt hinausgedurft, und die jungen Leute die Straße gemieden, weil immer ein Talib in der Nähe gewesen sei, der etwas an ihrem Aussehen auszusetzen hatte oder sie zwang, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen.
– Also waren die Taliban ein wirtschaftliches Problem für Sie?
– Nein, nein, antwortet Nur Agha, unter den Taliban habe ich mehr Geld verdient.
– Warum?
– Weil die Taliban Almosen verteilten. Heute gibt es selbst im Ramadan Nächte, an denen ich vor Hunger nicht einschlafen kann.
– Und warum ist es dann heute besser? hake ich nach.
– Weil wir heute frei sind, überrascht mich Nur Agha mit einer Antwort wie aus einer PowerPoint-Präsentation: Niemand sagt mir mehr, was ich tun, was ich sagen, wie ich meinen Bart tragen muß.
Ach ja, der 11. September 2001, komme ich auf den Tag genau zehn Jahre später meiner Pflicht als westlicher Berichterstatter nach: wie er dazu stehe? Nur Agha weiß nicht, was ich meine. Die Anschläge in Amerika, die Flugzeuge, die in die Hochhäuser flogen? Nur Agha schüttelt den Kopf. Damals habe es ja kein Fernsehen gegeben, bittet er um Verständnis für die Wissenslücke, und das Radio habe auch niemand einschalten dürfen.
Wir fahren mit den Themen fort, die auf dem Friedhof von Kabul dringlicher sind als der 11. September 2001, etwa der große Samowar, unter dem kein Feuer brennt. Er verkaufe keinen Tee mehr, dazu sei er zu alt und habe keine Lust mehr. Mit dem Geld, das ihm die Trauernden spendeten, halte er sich halbwegs über Wasser, aber seine Existenz sei ohnehin zerstört, Frau und Kinder tot, allein mit einem Schaf.
– Wenn jemand zum Leben hilft, nehme ich es gern an, aber wenn niemand mehr helfen sollte, sterbe ich ebenso gern.
Die Mauern vor den Mauern
Nach fünf Jahren zurück in Kabul, fallen mir als erstes die neuen Mauern
vor
den Mauern aller Gebäude auf, die den Staat, das Kapital oder das Ausland repräsentieren, davor eine dritte Wand aus Betonsäcken und Wachmänner mit Maschinengewehren. Nach einer ersten Begutachtung wird man vor eine Eisentür geführt und durch ein Sichtgitter ein weiteres Mal betrachtet. Öffnet sich die Tür, tritt man in eine Schleuse, in der die Tasche durchwühlt, der Ausweis kontrolliert und der Körper abgetastet wird. Schließlich klopft ein Herr, der als einziger kein Maschinengewehr trägt, gegen eine weitere Eisentür. Wieder öffnet sich ein Schiebefenster, ein kurzer Blick, dann darf ich endlich eintreten und stehe – vor derursprünglichen Mauer des Gebäudes. Das ist Standard geworden in den gehobenen Hotels, Restaurants, Banken und Shoppingmalls Kabuls, der Ablauf in drei Etappen wahrscheinlich normiert, nur daß vor Botschaften oder Ministerien bereits die Zufahrtsstraße gesperrt ist. Entsprechend haben die Hotels und Restaurants auch keine Schilder oder Leuchtreklamen, sind von außen nur an dem Vordach aus Eisen und dem Stacheldraht über dem äußeren Sandwall zu erkennen.
Ist das Leben also noch unsicherer geworden? Nein, antworten alle oder jedenfalls alle gewöhnlichen Menschen in Kabul, die nicht dem Staat, dem Kapital oder dem Ausland angehören, die ich in Kabul anspreche, auf Straßen, in Läden oder im Bekanntenkreis, nein, die Lage sei nicht gut, aber natürlich besser geworden. Einerseits verletzt es das Gebot der Höflichkeit, sich gegenüber Gästen zu beklagen, ausländischen Gästen gar; andererseits hat vor fünf Jahren kein Fahrer, Händler oder Bekannter von einer Besserung gesprochen. Was ich auf Anhieb sehe: daß jedenfalls im Zentrum die Armut nicht mehr so offensichtlich ist, keine
Weitere Kostenlose Bücher