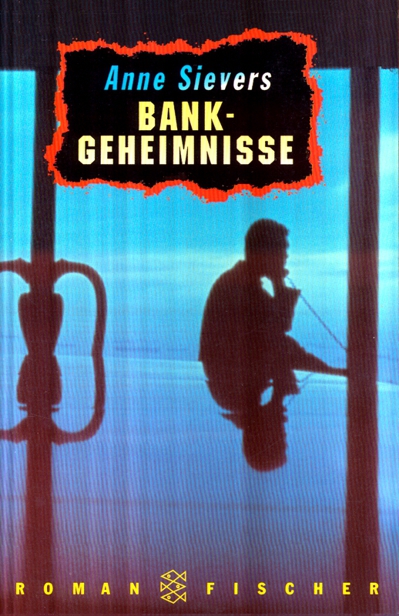![Bankgeheimnisse]()
Bankgeheimnisse
Niemand wird ihr mehr etwas zuleide tun können.«
»Was ist er für ein Mann, dein Schwager Ernesto?«
»Ein Geschäftsmann. Ein ziemlich einflußreicher Geschäftsmann, einer der bekanntesten in Neapel.«
»Und wie soll es deiner Vorstellung nach laufen, da in Neapel?«
»Wir fahren zu Ernesto. Sein Haus ist sicher. Es gibt eine hohe Mauer und Alarmanlagen.«
»Und weiter?«
»Wir warten, bis sie auftauchen, dann schnappen wir sie.«
»Mit anderen Worten: Du und dein Schwager Ernesto, ihr wollt euch hinter der Mauer verstecken und den Typen auflauern«, stellte sie amüsiert fest.
»So ungefähr.«
»Du meinst das ernst«, sagte sie ungläubig.
»Völlig ernst.«
»Du hast den Verstand verloren.«
Fabio lächelte und betrachtete sie versonnen. In der Morgensonne wirkte ihre Haut durchscheinend hell und zart. Ihre Augen waren so porzellanblau wie der Himmel über den Bergen. »Du hast recht, principessa. Was dich betrifft, habe ich meinen Verstand schon lange verloren.«
17. Kapitel
Hilda durchsuchte an diesem Sonntagmorgen bereits zum drittenmal ihre Handtasche. Sie klappte ihre Brieftasche auf, blätterte den Taschenkalender durch, und schließlich sah sie sogar in ihrem Schminktäschchen nach. Die Karte war nicht da. Sie wußte genau, daß sie am Freitag nachmittag noch in ihrer Brieftasche gewesen war. Nach dem Verlassen der Bank hatte sie die Karte in das dafür vorgesehene Sichtfenster geschoben, die Brieftasche zugeklappt und in das Seitenfach der Handtasche gesteckt. Das Sichtfenster war eine Spur zu eng für die Karte, Hilda mußte immer ein wenig zerren und rucken, um sie herauszuziehen. Es war völlig undenkbar, daß die Karte von allein herausrutschte. Und dennoch war sie weg.
Es war Zufall, daß sie es heute schon entdeckt hatte. Sie hatte nach einer anderen Karte gesucht, einer Visitenkarte, die ihr der Prinz einer früheren Nacht zugesteckt hatte, und dabei hatte sie festgestellt, daß ihre Codekarte nicht mehr da war. Die Visitenkarte hatte sie gefunden, nicht aber die Codekarte.
Wieder dachte sie an den schönen Prinzen mit den goldenen Augen, der mit ihr zu Mariah Careys Musik getanzt hatte und in dessen Armen sie sich köstlich geborgen gefühlt hatte. An seine dunkle, sinnliche Stimme, die ihr so seltsam vertraut erschienen war. Er hatte gestern abend ihre Verabredung im >Topas< nicht eingehalten. Auch der andere Prinz war nicht gekommen. Hilda und ihre Freundin hatten zwei Stunden lang gewartet, und die Enttäuschung in ihnen war gewachsen, zuerst langsam, dann schneller, bis sie zum Schluß in schmerzhafte Bitterkeit umgeschlagen war.
Hilda dachte intensiv darüber nach, wer seit Freitag abend Gelegenheit gehabt hatte, in ihrer Handtasche herumzuwühlen. Sosehr sie auch grübelte, sie kam immer wieder auf den treulosen italienischen Prinzen zurück. Und dann wußte sie plötzlich auch, warum er dieses Gefühl der Vertrautheit in ihr hervorgerufen hatte. Seine Stimme. Sie hatte seine Stimme wiedererkannt. Er hieß Scarlatti und war ein Bekannter von Johanna Herbst. Hilda warf die Handtasche zur Seite und griff zum Telefon.
Ernst hielt sich in einer trostlosen Pension in Neapel auf. Er saß in seinem Zimmer auf dem Bett und hielt das Mobilfunktelefon locker umfaßt. Die schäbige Umgebung störte ihn nicht sonderlich. Er würde nicht lange hierbleiben. Seine Reisen führten ihn durch die ganze Welt, und er hielt sich selten länger als ein paar Tage oder Wochen am selben Ort auf. Er reiste stets mit leichtem Gepäck. Das Handy war sein wichtigstes Gepäckstück. Es war sein Draht zur Außenwelt.
Er stand von dem quietschenden Bett auf und ging zum Fenster, das zur Straße wies. Sein Zimmer befand sich im sechsten Stock, es bot eine gute Aussicht. Auf dem Fensterbrett lag ein Feldstecher. Ernst hob ihn mit der freien Hand vor die Augen und starrte hindurch. Das, was er sah, hätte einen Menschen mit mehr Sinn für Ästhetik zu einem Ausruf des Entzückens veranlaßt, doch Ernst hatte wenig übrig für architektonische Schönheit. Er betrachtete die zeitlos eleganten Linien des Palazzos in der Ferne mit derselben klinischen Gründlichkeit, mit der ein Biologe einen Zellklumpen unter dem Mikroskop studiert hätte. Die Fassadengestaltung der Villa war von wunderbar strenger Symmetrie, und der Sandstein wies jene sanfte, im Laufe von Jahrhunderten entstandene Patina auf, die irgendwo zwischen Ocker und dunklem Elfenbein liegt. Das Gebäude lag inmitten eines gepflegten Parks, der
Weitere Kostenlose Bücher