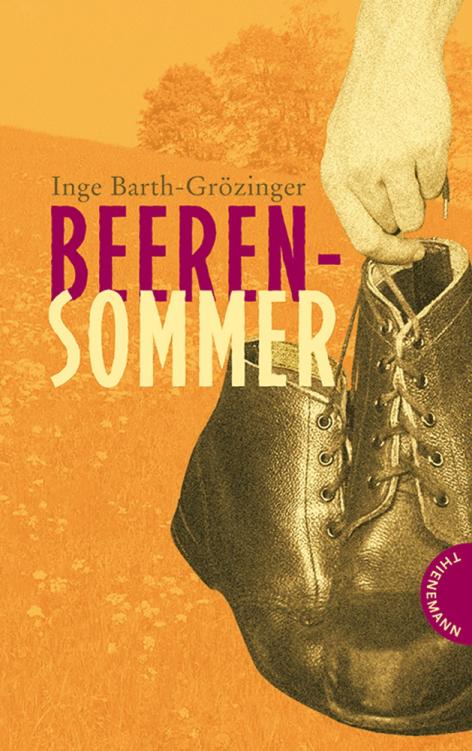![Beerensommer]()
Beerensommer
russische Großfürsten eingekauft und auch der Großherzog von Baden. Die Modelle ihrer Füße standen noch im Lager, jetzt stand seines ebenfalls da, an dem die Schuhe angemessen und angefertigt wurden.
»Am Schluss, Herr Weckerlin«, hatte Leopold Hobelsberger gesagt und dabei versonnen seine Zigarre betrachtet, »am Schluss, wer weiß das schon. Vielleicht ein Krieg, wenn es gar nicht anders geht. So kann es jedenfalls nicht bleiben. Ihre Branche hat doch auch nicht schlecht verdient damals, oder?«
Friedrich war es kalt über den Rücken gelaufen. Für einen Moment hatte er die Augen geschlossen und Bilder in einem bunten Wirbel vorüberziehen sehen. Darin kam immer wieder Johannes vor, Johannes mit seiner zerschossenen Schulter und seinen Kriegsgeschichten. Aber er verstand nichts von Politik, nur eines war ihm auch klar, und da musste er Hobelsberger recht geben: Es musste etwas geschehen. Er hatte schon zehn Arbeiter entlassen müssen, ein paar wenige Regierungsaufträge hielten ihn noch über Wasser und der übliche Kleinkram, ein paar Bretter, Balken ...
»Kommen Sie nach München, hören Sie sich den Mann einmal an«, hatte Hobelsberger eindringlich gesagt und zwei Schnäpse geordert. »Mit dem Prickelzeug kann ich nichts anfangen, ist was für die Damen. Prost, Herr Weckerlin!«
Friedrich hatte sein Glas in einem Zug geleert, es brannte in der Kehle, tat aber gut. Warum nicht? Ansehen konnte man sich den Mann, diesen Hitler doch.
»Allerdings gibt es noch eine Sache, Herr Hobelsberger«, hatte er gesagt. »Dieser Hitler, nun ja, wie soll ich sagen, dieser Hitler wird doch ziemlich ausfällig gegen Juden. Ich habe nämlich einen jüdischen Schwager.«
»Einen jüdischen Schwager, wie interessant«, hatte Herr Hobelsberger gesagt und war unmerklich etwas von ihm abgerückt. »Also einen Itzig in der Familie. Na ja, seine Verwandtschaft kann man sich schließlich nicht aussuchen.«
»Ich achte und respektiere meinen Schwager sehr«, hatte Friedrich gesagt und war nun seinerseits etwas von Herrn Hobelsberger abgerückt. Er hatte das tiefe Bedürfnis verspürt, noch einen Schnaps zu trinken.
»Nichts für ungut, Herr Weckerlin, war bloß ein Scherz.« Herr Hobelsberger hatte eine zweite Runde bestellt. »Der Hitler spricht da manchmal eine derbe Sprache. Aber keine Angst, wird nicht so heiß gegessen. Propaganda, nichts als Propaganda! Die breite Masse hört so etwas eben gern.« Und sie hatten noch ein paar Schnäpse getrunken und schließlich hatten sie ein Treffen in München ausgemacht und so saß er an diesem trüben Novembertag des Jahres 1932 in dem nach Bier und Rauch stinkenden Saal, wo jetzt die Männer in den braunen Uniformen in der Mitte Aufstellung nahmen, denn das Eintreffen des Parteiführers stand unmittelbar bevor.
Schlagartig war es ruhiger geworden im Saal, das Schreien und Rufen wich einem aufgeregten Summen, die Menschen dämpften ihre Stimme und reckten erwartungsvoll die Köpfe. Wenn das die neue Elite Deutschlands sein soll, dann gute Nacht, dachte Friedrich und betrachtete teils belustigt, teils angewidert die Gesichter der Braunhemden.
Flüchtig fiel ihm Caspar ein, Caspar mit seinem Rassefimmel. Und dann schob sich das Gesicht von Dr. Siegfried Löwenstein dazwischen, seinem Schwager, Emmas Mann. Er erinnerte sich daran, wie er zum ersten Mal die Wohnung der Löwensteins gesehen hatte, Emmas neues Zuhause, eine riesige Altbauwohnung im Stuttgarter Norden, in der auch das junge Paar wohnen sollte. Wie träumend war er damals durch die hohen Räume mit den Stuckverzierungen gegangen, hatte die vielen Bücherregale bewundert, die Rücken der Bücher studiert, Goldschnitt und Leder, tabakbraun und purpurfarben hatte es geleuchtet.
»Alle deutschen Klassiker«, hatte ihm Siegfried bedeutet, »mein Vater ist ein Büchernarr und Goethe und Schiller sind seine Götter.«
Friedrich hatte beschämt bemerkt, dass ihm viele der Namen, die da standen, gar nichts sagten; er hatte das feine Porzellan in den Glasvitrinen bewundert und den riesigen Flügel. Neid hatte sich geregt. Im Salon der neuen Villa wollte er so etwas auch haben, und Louis-Friedrich musste Klavier lernen, das stand fest. Und dann die vielen Bilder, nicht nur alte Schinken mit Landschaften, sondern ganz moderne Sachen waren darunter, soweit er das beurteilen konnte. Johannes würde das gefallen, hatte er unwillkürlich gedacht. Das war eigentlich Johannes’ Welt und dabei hatte er beklommen an die Villa in Grunbach
Weitere Kostenlose Bücher