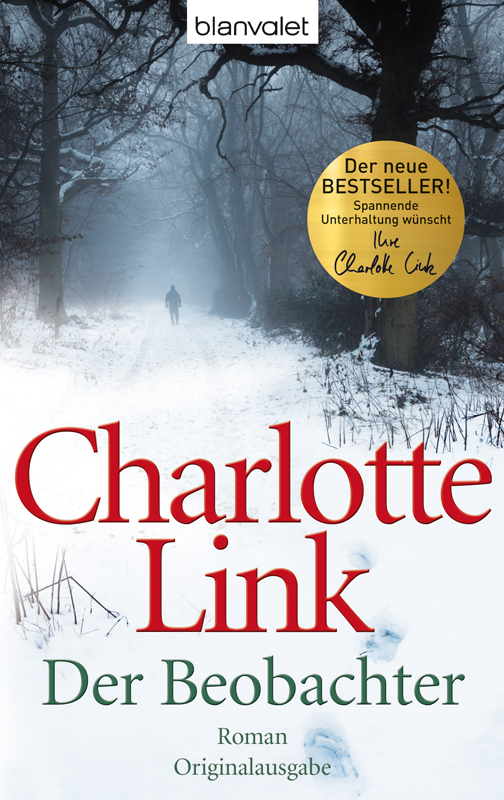![Beobachter]()
Beobachter
Hoffnung.
Weniger zuversichtlich war er, wenn er an seine Firma dachte. Die Recherchearbeit der letzten Tage wirkte sich ausgesprochen negativ auf seine Präsenz im Büro aus. Er hatte fähige Angestellte, aber es war wichtig, dass der Chef die Fäden in der Hand behielt, und daran mangelte es im Moment. Außerdem spürte er ein Schuldgefühl wegen Samson Segal. Er hätte sich längst wieder bei ihm blicken lassen müssen. Der arme Kerl war wirklich mutterseelenallein da draußen und vermutlich der Verzweiflung nahe. John fühlte sich für ihn verantwortlich, aber anstatt sich um ihn zu kümmern, spielte er mittlerweile die Rolle eines privaten Ermittlers, der sich auf die Fährte einer verschollenen Frau gesetzt hatte und nun stundenlang auf Gelegenheiten warten musste, die ihn weiterbringen würden. Der Unterschied war, dass ein richtiger privater Ermittler im Regelfall für seine Arbeit bezahlt wurde. Während er, John, die Arbeit, mit der er seinen Lebensunterhalt verdiente, gewaltig vernachlässigte.
Egal. Er hatte damit angefangen. Er würde es zu Ende bringen.
Um vier Uhr kam Bewegung auf. Erste Schüler kamen aus der Schule, bald drängten größere Mengen hinterher. Die ruhige, verschneite Straße war plötzlich kaum mehr wiederzuerkennen. Rufen, Lachen und Schreien erfüllte sie, es wimmelte von Kindern und Jugendlichen. John stieg aus seinem Auto und sah sich konzentriert um. Er hoffte, dass ihm Finley in dieser Menschenmenge nicht entwischen würde.
Zugleich behielt er die Straße und andere parkende Autos sehr genau im Blick. Nicht auszuschließen, dass Dr. Stanford persönlich aufkreuzen würde, um seinen Sohn abzuholen. John scheute nicht die Konfrontation mit ihm, aber ihm war bewusst, dass seine Chancen, Finley noch einmal allein zu erwischen, gegen null tendierten, sollte Stanford ihn hier vor der Schule ertappen. Vermutlich ließ er den Jungen dann keinen Moment mehr unbeaufsichtigt, und wenn er einen Bodyguard engagieren musste.
Allerdings konnte John ihn weit und breit nicht entdecken. Gut so. Irgendwann musste der Mann für sein vieles Geld ja auch einmal arbeiten.
Finley tauchte so plötzlich vor ihm auf, dass John fast erschrocken zusammengezuckt wäre. Er kam nicht wie die meisten anderen in einer großen, lärmenden Traube daher, sondern ging völlig alleine. Er erkannte John und trat auf ihn zu. Er sah ihn einfach nur an, aus ruhigen, sanften Augen.
»Hallo, Finley«, sagte John und überflog noch einmal rasch die Umgebung aus den Augenwinkeln. Immer noch kein Dr. Stanford in Sicht.
»Hallo, Mr. Burton«, sagte Finley. »Mein Vater hat gesagt, ich soll nicht mit Ihnen sprechen.«
»Ja, das habe ich vermutet. Und ich weiß, dass ich viel von dir verlange, wenn ich dich bitte, dich darüber hinwegzusetzen. Aber es ist wichtig. Es geht um deine Mutter.«
Finley wirkte hin- und hergerissen. Er wollte nicht tun, was sein Vater ausdrücklich verboten hatte, aber er war auch ein Kind, das sich nach seiner Mutter sehnte.
»Sie kennen meine Mutter aber nicht?«, fragte er.
»Nein«, gab John zu. »Ich kenne sie nicht. Aber es wäre wichtig, mit ihr zu reden. Es wäre wichtig für jemand anderen, den ich gut kenne.«
Finley hob beide Schultern. »Ich weiß nicht, wo sie ist.«
»Hast du ein Bild von ihr?«, fragte John.
Finley nickte. Er ließ seinen Schulranzen vom Rücken rutschen, stellte ihn vor sich in den Schnee und suchte darin herum. Aus einem Geldbeutel zog er schließlich ein Foto hervor. »Das ist sie.«
John betrachtete das Bild. Eine schöne Frau, wie er sogleich feststellte. Lange blonde Haare, auffallend große Augen. Ein fein geschnittenes Gesicht. Aber er gewahrte auch den gehetzten Ausdruck, die Angst in den Augen. Zeichen einer Depression? Oder gab es ganz konkrete Ängste, die das Leben von Liza Stanford vergifteten?
Er gab das Bild zurück. »Sie ist sehr schön«, sagte er.
Finley nickte. »Ja.«
»Dein Vater ist im Büro?«
»Ja. Er kommt erst heute Abend wieder.«
»Du würdest jetzt mit dem Bus heimfahren, oder?«
»Ja.«
»Wenn du möchtest, bringe ich dich nach Hause. Und wir könnten unterwegs ein bisschen reden.«
Finley schüttelte energisch den Kopf. »Ich steige nicht zu einem Fremden ins Auto.«
»Okay. Du hast absolut recht. Aber opferst du mir hier auf der Straße fünf Minuten? Für ein Gespräch?«
»Mein Bus geht erst in zehn Minuten«, sagte Finley.
»Gut. Finley, verstehst du, der Gedanke ist kaum nachvollziehbar, dass ein Mensch ohne
Weitere Kostenlose Bücher