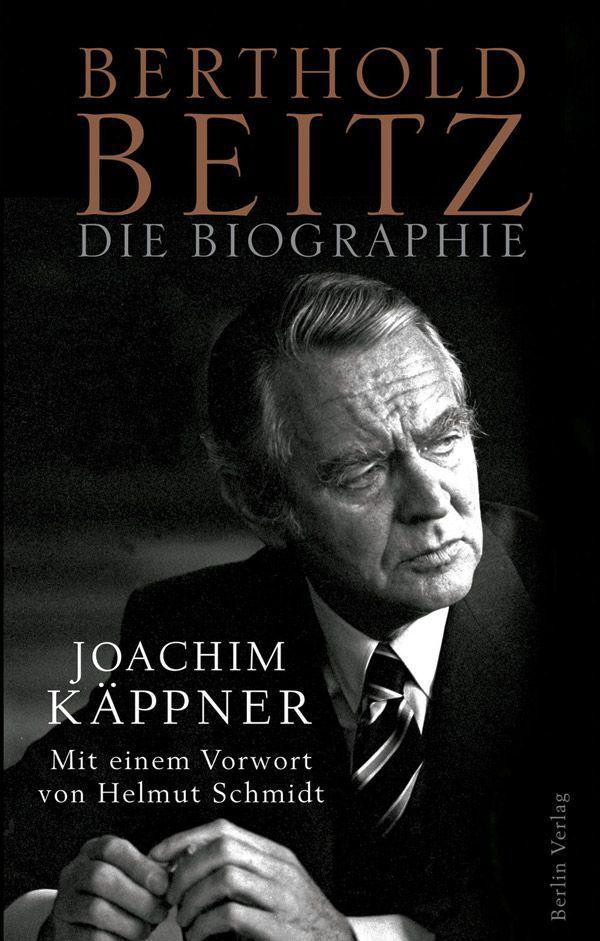![Berthold Beitz (German Edition)]()
Berthold Beitz (German Edition)
sind die Eigentümer, auf uns müssen sie hören, nicht auf die Herren Beitz und Vogelsang.«
Rückblickend meint Vogelsang: »Diese Fusion kam zustande, einfach weil zwei Männer das für richtig hielten und zusammen den richtigen Weg gefunden haben. Es war eine schöne Zeit – und wir beide waren das Kraftfeld.« Beitz stimmt zu: »Das ist gut gelaufen, wir saßen dort, aßen gut, sprachen intensiv, es gab keine Schriftsätze, und wir haben die Lösungen gefunden.«
Im März 1999 ist alles geschafft: Nach langen Verhandlungen und nicht minder langen organisatorischen Vorbereitungen fällt der Startschuss für die vereinte Firma ThyssenKrupp; die Zentrale bleibt vorerst im Düsseldorfer Hauptquartier von Thyssen; 2010 zieht sie nach Essen, in einen spektakulären Neubau auf dem Gelände der früheren Krupp-Fabrik an der Altendorfer Straße. Das Gemeinschaftsunternehmen mit fast 190 000 Arbeitsplätzen ist unter anderem der größte Konzern für Edelstahl in Europa, und die Fusion im Konsens hat lediglich 2000 Jobs gekostet, die bald, in späteren Boomjahren, wieder neu entstehen werden. Weil Thyssen weit mehr in die Zweckehe miteingebracht hat, wird Heinz Kriwet auch Aufsichtsratschef des neuen Konzerns. Beitz und Vogelsang sind Ehrenpräsidenten.
Ende gut, alles gut? Anfangs hat es nicht den Anschein, jedenfalls nicht für Berthold Beitz. Der Kurs der neuen Firmenaktien bleibt auch noch zwei Jahre nach der Fusion von 1999 weit unter den Erwartungen. Bedenklich erscheint Beitz vor allem, dass die Fusion zwar faktisch vollzogen ist, dass letztlich aber immer noch zwei Lager bestehen. Schulz und Cromme bemühen sich durchaus um eine gemeinsame Linie, doch der Vorstand ist insgesamt zu groß und zu sehr nach Proporz zusammengesetzt. Aufsichtsratschef Kriwet will daran nichts ändern und trägt nach Meinung vieler noch immer eine gewisse »Krupp-Phobie« zur Schau.
Pannen und Pleiten kommen hinzu. So schon bei einem Treffen der großen Anteilseigner in der Villa Hügel. Die Teilnehmer, Kriwet voran, halten es für eine großartige Geschäftsidee, den kanadischen Stahlhersteller Dofasco zu kaufen, man gerät aber in eine erbitterte Übernahmeschlacht mit dem Konzern Arcelor und verliert. Arcelor wird dennoch später selbst Opfer einer feindlichen Übernahme durch den indischen Stahlriesen Mittal.
Schließlich, im März 2001, wird Kriwet entthront. Beitz hält Kriwet persönlich zwar für einen Ehrenmann, sieht in ihm aber auch einen der Verantwortlichen für die ungute Lagerbildung im Konzern. Dementsprechend mobilisiert er seine Truppen gegen den Chefkontrolleur. Die Stiftung hält fast 17,36 Prozent, die Iraner 7,69 Prozent, die Commerzbank und die Allianz gemeinsam etwa weitere sieben Prozent. Zusammen mit kleineren Anteilseignern ist das eine mächtige Front. Zu einer dramatischen Schlussszene kommt es auf dem Hügel in Essen. Hier empfängt Beitz den Aufsichtsratschef, flankiert von Friedel Neuber und dem Iraner Navab-Motlagh. Die drei nehmen Kriwet in die Zange: Entweder Kriwet nimmt seinen Hut, oder das Bündnis der Großaktionäre wird dafür sorgen, dass die Hauptversammlung ihn nicht entlastet. Dazu würde genügen, dass die drei die zahlreichen Abwahlanträge gegen Kriwet unterstützen, die wegen »desolater Führungslosigkeit« und ähnlichen Vorwürfen für die Aktionärsversammlung eingereicht worden sind. Kriwet ist in diesem Augenblick jedoch zu stolz, um einzuknicken.
In den Tagen vor der Hauptversammlung sackt der Aktienkurs gleichwohl ab. Die Anleger mögen keine Konzerne mit Führungsproblemen, und die bei ThyssenKrupp haben sich längst herumgesprochen. Und als sich am 2. März in der Duisburger Mercatorhalle mehr als 5000 Menschen drängen, Aktionäre und ein Großaufgebot von Journalisten, da bleibt der Showdown aus. Kriwet erklärt seinen Verzicht: Im Herbst werde er den Vorsitz des Aufsichtsrats niederlegen. Die Doppelspitze im Vorstand ist damit Geschichte, denn Cromme übernimmt den Posten von Kriwet – eine symbolträchtige Entscheidung.
Berthold Beitz, der Kriwet weiterhin sehr schätzt, hat seinen letzten großen Kampf um Krupp endgültig gewonnen. Die Fusion mit Thyssen, so quälend lange sie sich hingezogen hat, ist die vierte Entscheidung über den Konzern, die eng mit seinem Namen verbunden ist – nach dem Erbverzicht Arndts 1966, dem Kampf gegen die Banken 1967 bis 1970 und der Iran-Beteiligung 1974/76. Und auch diesmal ist die Entscheidung weit über den eigentlichen Konzern
Weitere Kostenlose Bücher