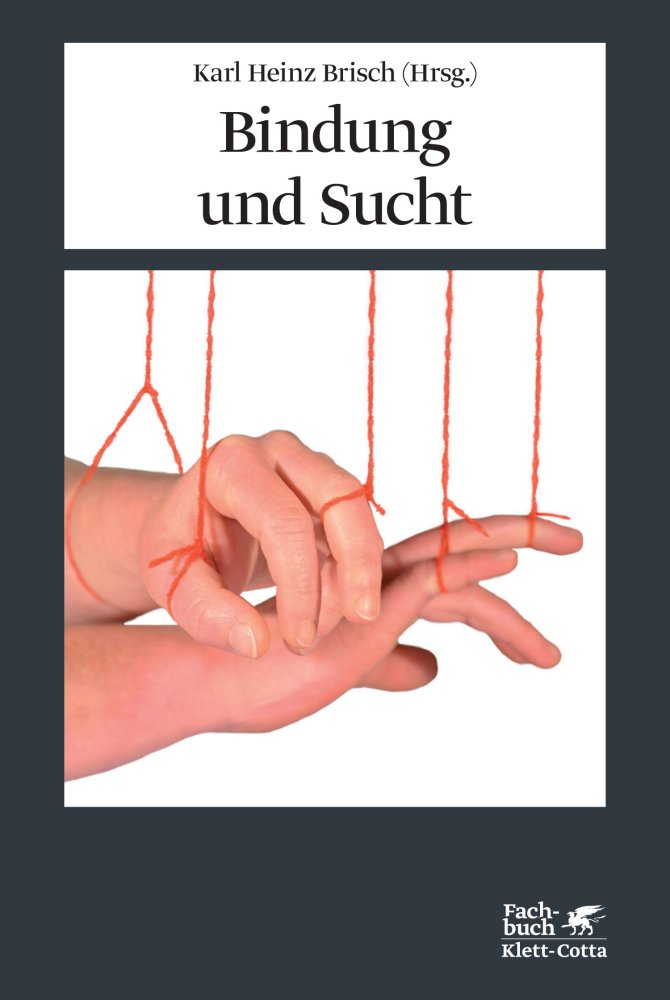![Bindung und Sucht]()
Bindung und Sucht
ZNS (Miller et al. 2009) sowie auf eine Reihe genetischer Grundlagen solcher autonomen psychophysiologischen Probleme (Levinson 2006) konzentriert; neue Medikamente sind dabei allerdings nicht entwickelt worden. Das liegt vielleicht daran, dass solche Strategien kaum Einblick in die affektiven Gefühle ermöglichen, die die Depression kennzeichnen. Insoweit wollen wir der Frage nachgehen, ob und wie ein gezielteres neurowissenschaftliches Vorgehen zum besseren Verständnis der kausalen Hintergründe des depressiven Affekts führen kann (wie dies z. B. angesprochen wird bei Burgdorf et al. 2011; Kroes et al. 2007; Watt & Panksepp 2009).
Hier entwickeln wir den Gedanken, dass eine Analyse der emotionalen Systeme nicht nur den notwendigen interdisziplinären Dialog fördern, sondern auch zu Formen der therapeutischen Intervention führen wird, die konkreter sind als das gegenwärtige Angebot sowohl der biologischen Psychiatrie (die noch immer mit Amin-Manipulationen arbeitet) wie auch der Psychotherapie, die den Akzent auf die kognitive Steuerung und die Verhaltensregulierung legt, und dies häufig auf Kosten der eher unmittelbar affektorientierten Behandlungsformen (zu solchen Interventionen siehe aber Fosha et al. 2009 und vor allem Shedler 2010; die letztgenannte Arbeit fasst eindrucksvolle Belege für die Wirksamkeit emotionsbasierter psychodynamischer Ansätze zusammen).
Im Gegensatz zu den gebräuchlichen verhaltensorientierten Ansätzen tendiert man in den affektiven Neurowissenschaften eher zur Arbeit mit präklinischen Modellen und zu dem Versuch, depressive Kaskaden durch direkte Stimulierung der für die negativen Affekte zuständigen Areale des Gehirns einzuleiten und zugleich dauerhafte Veränderungen des Affekts durch validierte Messungen dernachlassenden Fähigkeit zur Wahrung positiver sozialer Affekte zu überwachen (Wright & Panksepp 2011). Die Entwicklung neuer Arzneimittel wird durch die zunehmende Kenntnis der Veränderungen in den relevanten genetischen und neurochemischen Systemen des Gehirns (vgl. z. B. Burgdorf et al. 2011; Moskal et al. 2011; Normansell & Panksepp 2011) begünstigt, wobei der Gedanke mitspielt, dass Suchtmittelabhängigkeiten vielfach deshalb entstehen, weil die betreffenden Individuen versuchen, durch Einnahme von Suchtmitteln zum emotionalen Gleichgewicht zu finden (Panksepp 1981; Panksepp et al. 1980). Wie wir hier darlegen werden, können neurowissenschaftliche Konzepte und Methoden an der psychotherapeutischen Front für eine bessere und gezieltere Nutzung positiver Emotionen sorgen, etwa durch die Förderung der Dynamik der SEEK-ING-, CARE- und PLAY-Systeme, sei es auf psychologischen oder biologischen Wegen, oder durch die Tiefe Hirnstimulation (THS) der relevanten affektiven Schaltkreise (Bewernick et al. 2010; Coenen et al. 2011; Mayberg 2009; Schläpfer et al. 2008).
Warum ist die Depression ein so schmerzliches Gefühl?
Ein Blick aus der Perspektive der affektiven Neurowissenschaften
Nach der auf Bowlbys Theorie fußenden ausführlichen Analyse der Depression, die wir unlängst vorgestellt haben (Watt & Panksepp 2009), wollen wir unsere diesbezüglichen detaillierten Überlegungen hier nicht wiederholen. Vielmehr möchten wir an dieser Stelle betonen, dass die affektive Neurowissenschaft genau umschriebene Hirnnetzwerke nennen kann, die zur Erklärung des psychischen Schmerzes und der allgemeinen Dysphorie der Depression beitragen können, zumal im Zusammenhang mit einer Überaktivität des PANIC-Systems und einer Unteraktivität des SEEKING-Systems. Das PANIC-System gilt als primäres oder Basissystem für den psychischen Schmerz, wie er durch einen sozialen Verlust zustande kommt (Panksepp 2003 a, b; 2005 b; 2010 a, b), und damit als ein konzeptuell eindeutiger »Gründungsprozess« für diesen größten epidemiologischen Stressor, der sehr häufig zur Depression führt (Bowlby 1980; Heim & Nemeroff 1999).
Zu einer soliden neurowissenschaftlichen Erfassung dieser Hirnprozesse sind wir durch die Kartierung der neuroanatomischen und neurochemischen Strukturen des Trennungsschmerzes gelangt, die uns spezifische Informationen über soziale Bindungen und Verlusterfahrungen liefern, wie in Abbildung 1 (S. 216) zusammengefasst (Panksepp 1998, 2003 b). Interessant ist, dass diese gleichenProzesse diverse Formen des Suchtverlangens vermitteln, wie sie sich aus den elementaren Bindungssystemen des Gehirns ergeben können (Panksepp 1981).
Abb. 1: Das menschliche und
Weitere Kostenlose Bücher