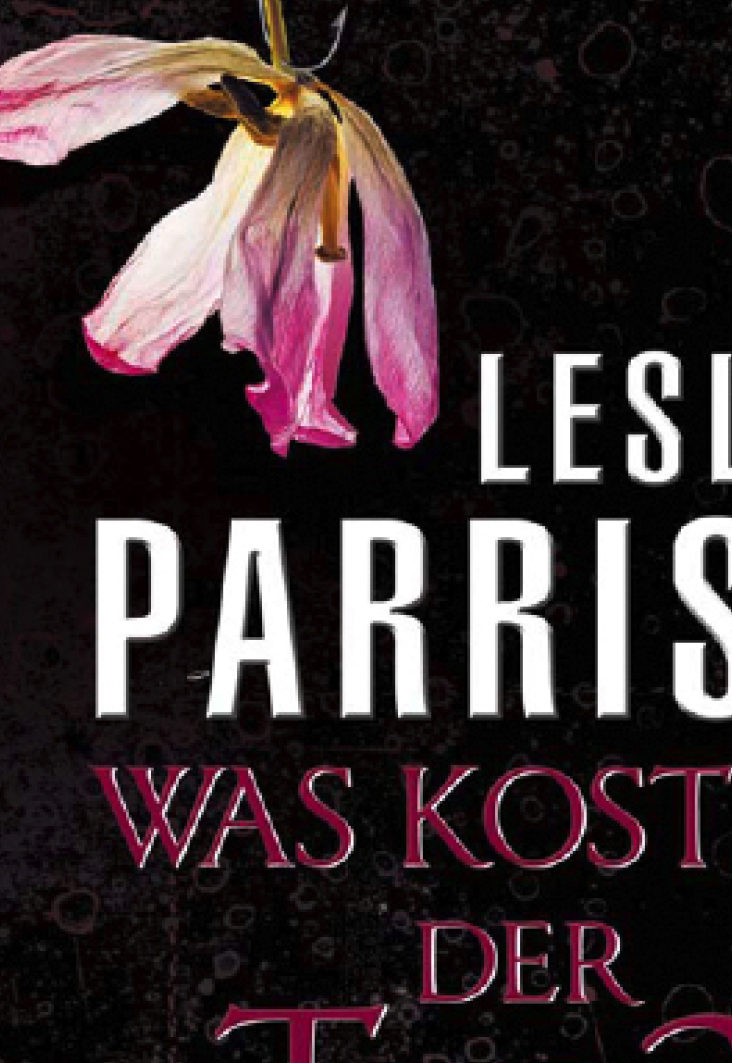![Black Cats 01. Was kostet der Tod]()
Black Cats 01. Was kostet der Tod
erfuhr.
Dann dachte sie an ihren Bruder und sagte: »Tim hat mich vor ein paar Tagen besucht.«
Seine Mundwinkel sanken herab. »Ich habe davon gehört.«
Das war ja klar gewesen. Stacey bezweifelte, dass Connie diese Neuigkeiten ausposaunt hatte, denn sie versuchte Dad möglichst jede Aufregung zu ersparen. Höchstwahrscheinlich war ihr Bruder zu ihm gekommen und hatte sich lauthals darüber aufgeregt, wie unfair es war, dass seine zickige Schwester ihm in der Not nicht beisprang. Als ob sie – und alle anderen auch – nicht genau das getan hätte, seit er vor zwei Jahren nach Hause gekommen war – verletzt und so durch den Wind, dass sie ihn fast nicht wiedererkannt hätte.
»Dad, er wird nie lernen, sich selbst zu helfen, wenn wir ihm immer wieder aus der Patsche helfen. Er braucht keine Familie, die ihn die ganze Zeit beschützt – genauso wenig wie einen Kumpel, der ihm am laufenden Bande Ärger einbrockt.«
»Randy ist immer für ihn da gewesen.«
»Ich weiß. Aber ein Freund, der ihn in seiner Wut und seinem Groll nur bestärkt, der ihn außerhalb der Saison mit auf illegale Jagden nimmt oder sieben Tage die Woche mit ihm saufen geht, ist nicht unbedingt das, was ihm gerade guttut. Er muss wieder zurück ins Militärkrankenhaus und mit diesem Seelenklempner reden. Er hätte nicht einfach nach ein paar Monaten aufhören sollen dorthin zu gehen.«
Er erwiderte ihren Blick. »Ich weiß, dass du recht hast. Rein verstandesmäßig weiß ich das.« Er legte seine andere Hand auf ihre. »Aber er ist mein Sohn. Wenn ich ihn ansehe, wenn ich diese Narben sehe und darüber nachdenke, was er durchgemacht hat und … « Er äußerte keine Bitte. Sprach keine Forderung laut aus. Aber das brauchte er auch nicht – der gequälte Ausdruck in seinen Augen reichte völlig.
Stacey schüttelte den Kopf. Sie wusste, dass Hilfe zur Selbsthilfe das Erste wäre, was ihr Vater allen anderen Eltern nahelegen würde, und zog ihre Hand zurück. »Ich werde sehen, was ich tun kann.«
»Danke, mein Schatz!«
Sie fragte sich, ob er ihr immer noch dankbar sein würde, wenn Tim seinen Kram nie auf die Reihe kriegte, nie aus dieser dunklen Wolke von Wut herauskam, die ihn einhüllte und nichts mehr von dem jungen Mann erkennen ließ, der begeistert Football und Bassgitarre gespielt hatte. Dem immer ein Lächeln auf den Lippen gelegen hatte.
Jedenfalls würde er es nicht schaffen, wenn er nur noch mit Randy herumhing und sie sich gemeinsam besoffen und Blödsinn anstellten wie zwei Teenager. Schon als sie klein waren, hatte Randy Tim unentwegt durch Diebstahl und Prügeleien in dumme Situationen gebracht. Sie wünschte wirklich, ihr Bruder hätte die Freundschaft nicht wieder aufleben lassen, als er nach Hause kam.
»Ich muss los. Du behältst den Fall im Hinterkopf, ja? Und gibst mir Bescheid, wenn dir irgendwas einfällt, was uns weiterhelfen könnte?«
»Ja, das mache ich.« Er stand auf, legte ihr die Hände auf die Schultern, sah sie besorgt an und sagte: »Sei vorsichtig. Lass den FBI -Leuten den Vortritt bei dieser Sache. Mir gefällt die Vorstellung überhaupt nicht, dass du jemandem gegenübertrittst, der so teuflisch ist.«
Teuflisch. Ja, das beschrieb den Mann, hinter dem sie her waren, ziemlich gut. Konnte Stan Freed, wenn er auch ein hundsgemeiner und möglicherweise degenerierter Grobian war, so teuflisch sein?
»Ich weiß, dass du mit so etwas nicht gerechnet hast, als du zurückkamst und deinen alten Vater abgelöst hast«, murmelte er und blickte ihr aufmerksam ins Gesicht, als suche er nach Anzeichen dafür, dass sie vor einem Zusammenbruch stand. Vielleicht befürchtete er, dass die Grausamkeit, die sie bis hierher in ihre kleine Heimatstadt verfolgt hatte, ihr zu nahe gehen und sie der Belastung nicht standhalten würde.
Es ging ihr nicht zu nahe. Und sie würde es aushalten. Basta!
»Mir wird schon nichts passieren.« Sie gab ihrem Vater einen Kuss auf die Wange und sah ein, dass er ein Recht darauf hatte, sich Sorgen um seine Tochter zu machen und nicht nur den Sheriff bei seiner Arbeit zu unterstützen. Während sie sich umdrehte, um die Stufen hinabzusteigen, schaute sie noch einmal über die Schulter und sagte lächelnd: »Wünsch Connie einen guten Morgen von mir!«
Sein überraschtes Kichern erleichterte es Stacey, ihn allein auf der Veranda zurückzulassen. Außerdem wusste sie, dass das wohl einer der wenigen fröhlichen Momente an diesem Tag sein würde.
Sie hatten Staceys Büro zur
Weitere Kostenlose Bücher