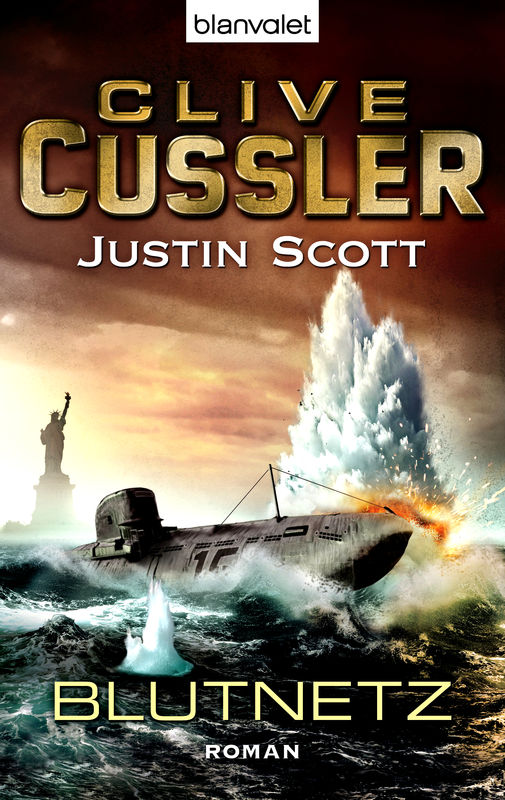![Blutnetz]()
Blutnetz
Privatdetektiv kennenzulernen gehört Sicherlich auch in diese Kategorie.«
Bell nickte. »Ich freue mich schon darauf. Wie heißt sie denn?«
Riker hatte die Frage anscheinend nicht gehört. Oder wenn er sie gehört hatte, zog er es vor, sie nicht zu beantworten. Stattdessen sagte er: »Sicherlich wird es genauso interessant sein, sich mit einer Frau unterhalten zu können, die im Filmgeschäft tätig ist. Mr Bell, warum so überrascht? Natürlich weiß ich, dass Ihre Verlobte Kinofilme dreht. Ich habe Ihnen doch bereits erklärt, dass ich mein Gewerbe nicht vollkommen blind betreibe. Ich weiß, dass Sie sich das Beste leisten können, und ich weiß auch, dass Ihre Verlobte das Beste, das ich anzubieten habe, mit kundigem Blick prüfen wird. Zusammen stellen Sie beide eine Herausforderung für mich dar. Ich kann nur hoffen, dass ich ihr auch gewachsen sein werde.«
Shafer kehrte zurück. Fr hatte sein Gesicht mit Wasser benetzt. Dabei war etwas auf seine Krawatte gespritzt. Aber er lächelte. »Sie haben einen sehr scharfen Blick, Mr Bell. Ich dachte, als ich meine Uniform ablegte, ließe ich auch meine Vergangenheit hinter mir. Ist es typisch für Versicherungsleute, solche Diskrepanzen aufzuspüren?«
»Wenn ich Ihnen eine Versicherung verkaufe, dann gehe ich ein Risiko ein«, erwiderte Bell. »Also achte ich am besten immer darauf, dieses Risiko so gering wie möglich zu halten.«
»Wäre Herr Shafer ein guter Kandidat?«, fragte Riker.
»Männer mit festen Gewohnheiten sind immer gute Kandidaten. Herr Shafer, ich entschuldige mich, dass ich den Eindruck erweckt habe, meine Nase in Dinge gesteckt zu haben, die mich nichts angehen.«
»Ich habe nichts zu verbergen!«
»Apropos verbergen«, sagte Riker, »offenbar versteckt sich der Steward gerade. Wie zum Teufel bekommt man hier einen frischen Drink?«
Bell nickte und sah sich um. Ein Steward eilte herbei und nahm ihre Bestellung auf.
Arnold Bennett wandte sich an seine chinesischen Begleiter. »Gentlemen, Sie sehen müde aus.«
»Nein, Sir. Uns geht es gut.«
»In einem Eisenbahnzug findet man nur wenig Schlaf. Der Luxus mag keine Grenzen haben - Schneiderei, Bibliothek, Maniküre, sogar heiße Bäder in Frisch- oder Meerwasser. Aber anders als in Europa, wo die besten Züge mit der Verstohlenheit einer schlechten Angewohnheit anfahren, habe ich in einem amerikanischen Schlafwagen niemals auch nur eine Stunde ungestört geschlafen - dank der abrupten Stopps, der ebenso abrupten Starts, der ständigen lauten Pfeifsignale und der scharfen Kurven, die oft auch noch in waghalsigem Tempo genommen werden.«
Reisende aus Chicago quittierten diese Kritik mit lautem Gelächter und meinten, das sei eben der Preis der Geschwindigkeit und jeden Penny wert.
Isaac Bell wandte sich wieder zu seinen deutschen Mitreisenden um - Erhard Riker, der so englisch, ja, geradezu amerikanisch erschien, und Herrn Shafer, der sich teutonisch wie aus einer Wagner-Oper entsprungen gab. »In Gesellschaft von nicht nur einem, sondern gleich zwei Untertanen des Kaisers muss ich fragen, was es mit dem Gerede vom Krieg in Europa auf sich hat.«
»Deutschland und England sind Konkurrenten und nicht verfeindet«, antwortete Riker.
»Unsere Nationen sind gleich stark«, fügte Shafer schnell hinzu. »England besitzt mehr Kriegsschiffe. Dafür haben wir die größere Armee - die modernste und fortschrittlichste und beste der Welt.«
»Aber nur in den Teilen der Welt, in die Ihre Armee einmarschieren kann«, bemerkte Arnold Bennett vom Nachbartisch.
»Was soll das heißen, Sir?«
»Ein hochrangiger Militär unserer amerikanischen Gastgeber, Admiral Mahan, hat es einmal sehr treffend ausgedrückt: ›Diejenige Nation, die die Ozeane beherrscht, beherrscht die ganze Welt .‹ Ihre Armee ist keinen Pfifferling wert, wenn sie nicht dorthin gelangen kann, wo gekämpft wird.«
Shafer lief rot an. Eine Ader pulsierte an seiner Schläfe.
Riker besänftigte ihn mit einer Handbewegung und erwiderte: »Es gibt keinen Kampf. Dass von Krieg gesprochen wurde, war nichts als dummes Gerede.«
»Warum bauen Sie dann so viele neue Kriegsschiffe?«, konterte der englische Schriftsteller.
»Warum tut England es?«, hielt ihm Riker lächelnd entgegen.
Die Chicagoer und die chinesischen Theologiestudenten blickten zwischen den Deutschen und dem Engländer hin und her wie Zuschauer bei einem Tennismatch. Zu Isaac Beils Überraschung beantwortete einer der stummen Chinesen noch vor dem Schriftsteller
Weitere Kostenlose Bücher