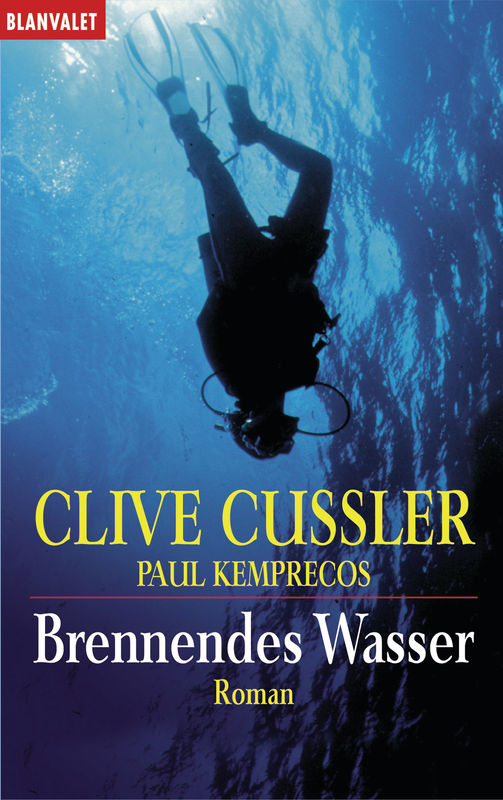![Brennendes Wasser]()
Brennendes Wasser
Punkt mussten Paul und Gamay die Fahrt unterbrechen, weil Treibholz jedes weitere Vorankommen zunächst unmöglich machte. Der Zwischenfall kam ihnen gelegen, bedeutete er doch etwas Abwechslung von dem einschläfernd monotonen Propellergeräusch des Boots. Mit Hilfe von Seilen gelang es ihnen, das Gewirr aus Stämmen und Ästen zu entflechten und den Engpass zu überwinden. Die Aufgabe erwies sich als ziemlich zeitaufwendig, und so war es bereits später Nachmittag, als die belaubte Uferbarriere sich auflockerte und erste kurze Ausblicke auf offenes Gelände und bebaute Äcker gestattete. Dann kamen auf einer größeren Lichtung mehrere strohgedeckte Hütten in Sicht.
Paul reduzierte die Geschwindigkeit und richtete den stumpfen Bug des Boots auf eine Lücke zwischen mehreren Einbäumen, die auf der schlammigen Böschung lagen. Er erhöhte kurz den Schub, glitt mit dem Fahrzeug an Land und schaltete den Motor aus. Dann nahm er die NUMA-Baseballmütze vom Kopf und fächelte sich damit etwas Luft zu.
»Wo sind denn bloß alle hin?«
Die unheimliche Stille stand in deutlichem Gegensatz zu Dr. Ramirez’ Dorf, wo die Eingeborenen stets geschäftig ihrem Tagewerk nachgingen. Dieser Ort hingegen schien verlassen zu sein. Nur ein paar graue Rauchfahnen über den Feuerstellen ließen erkennen, dass sich noch vor kurzem Menschen hier aufgehalten hatten.
»Wie seltsam«, sagte Gamay. »Als wäre irgendeine Seuche ausgebrochen.«
Paul klappte den Deckel eines Staukastens auf und holte einen Rucksack daraus hervor. Dr. Ramirez hatte darauf bestanden, den Trouts einen langläufigen Revolver, einen Colt, mitzugeben.
Langsam stellte Paul den Rucksack zwischen sich und Gamay, griff hinein, öffnete die Sicherungslasche des Holsters und legte die Hand um den beruhigend kühlen Kolben der Waffe.
»Ich würde nicht unbedingt auf eine Seuche tippen«, sagte Paul leise und musterte die leeren Hütten. »Stattdessen muss ich die ganze Zeit an diesen toten Indio und sein Kanu denken.«
Gamay hatte Paul nach dem Revolver greifen sehen. Auch sie war beunruhigt.
»Sobald wir das Boot verlassen haben, kommen wir womöglich nicht mehr so leicht zurück an Bord«, sagte sie. »Lass uns noch ein paar Minuten abwarten, ob etwas passiert.«
Paul nickte. »Vielleicht halten die Leute hier gerade eine Siesta ab. Versuchen wir doch mal, sie zu wecken.« Er legte die Hände um den Mund und rief laut hallo. Nichts geschah. Er rief noch einmal. Wieder ohne Ergebnis.
Gamay lachte. »Wer von diesem Gebrüll nicht aufgewacht ist, muss schon einen ziemlich gesunden Schlaf haben.«
»Irgendwie unheimlich«, sagte Paul und schüttelte den Kopf.
»Mir ist zu heiß, um noch länger hier hocken zu bleiben. Ich werde mich ein bisschen umsehen. Gibst du mir Rückendeckung?«
»Ich behalte eine Hand auf dem Anlasserknopf und die andere auf der Pistole, die Dr. Ramirez uns mitgegeben hat. Spiel nicht den Helden.«
»Du solltest mich eigentlich besser kennen. Beim geringsten Anzeichen für Schwierigkeiten nehme ich die Beine in die Hand.«
Trout schob seinen schlaksigen Körper von dem Sitz vor dem Propellerkäfig und stieg hinab auf Deck. Er wusste, dass er sich auf seine Frau verlassen konnte. Als Kind in Racine hatte ihr Vater sie Tontaubenschießen gelehrt, und inzwischen beherrschte sie meisterhaft alle Arten von Feuerwaffen. Paul behauptete stets, sie könne einem springenden Sandfloh das Auge ausschießen. Er ließ den Blick abermals über das Dorf schweifen und ging von Bord, nur um sofort wie angewurzelt zu verharren. In der dunklen Türöffnung der größten Hütte hatte sich etwas bewegt. Jemand hatte kurz um die Ecke geschaut und prompt wieder den Kopf eingezogen. Da, noch einmal. Einige Sekunden darauf trat ein Mann aus der Hütte ans Tageslicht und winkte. Er rief etwas, das wie ein Gruß klang, und kam über den Abhang auf die beiden Neuankömmlinge zu.
Als er das Ufer erreichte, tupfte er sich das feuchte Gesicht mit einem fleckigen Taschentuch aus Seide ab. Er war groß und breit, und der hohe, ausladende Strohhut trug nur noch mehr zu seiner imposanten Erscheinung bei. Statt eines Gürtels hatte er sich ein Stück Nylonseil um den korpulenten Leib geschlungen und hielt damit die ausgebeulte weiße Baumwollhose an Ort und Stelle. Sein langärmeliges weißes Hemd war bis zum Kragen zugeknöpft, und vor seinem linken Auge funkelte ein Monokel in der Sonne.
»Willkommen«, sagte er mit leichtem Akzent. »Willkommen im Paris des
Weitere Kostenlose Bücher