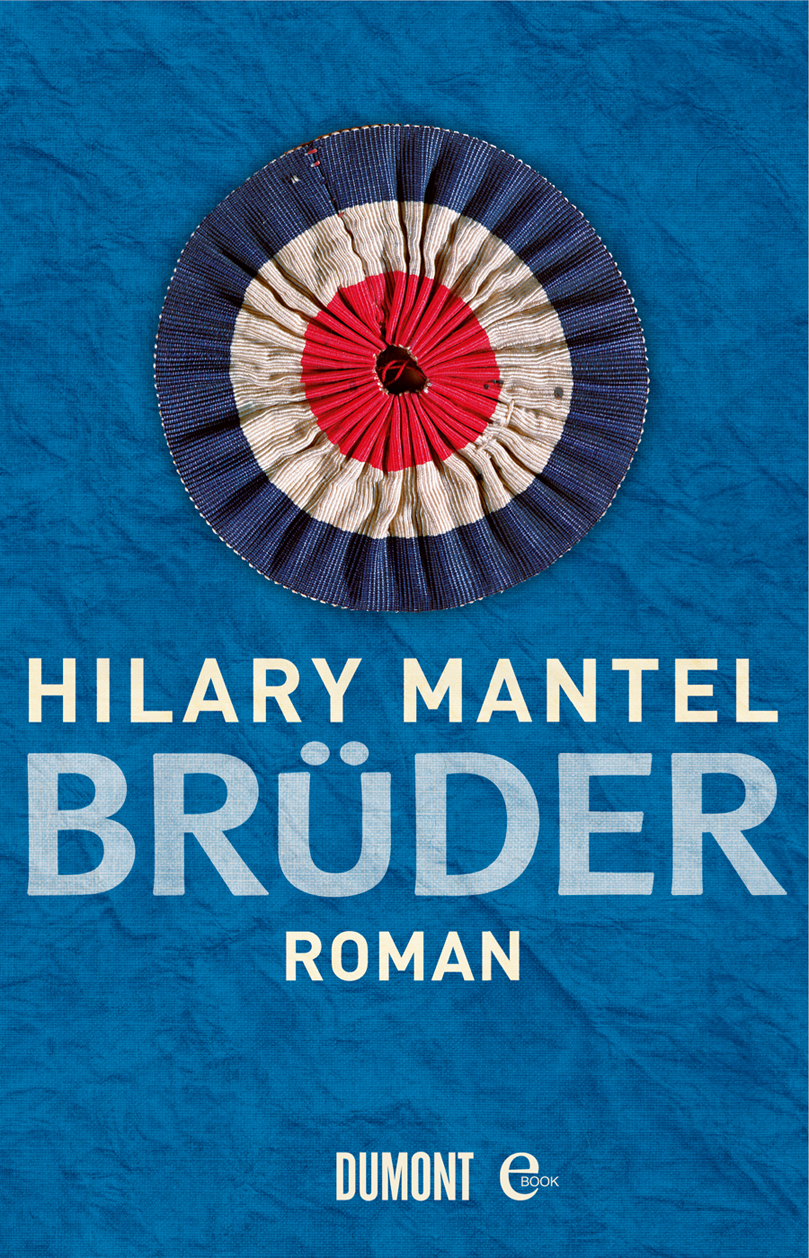![Brüder - Mantel, H: Brüder - A Place of Greater Safety]()
Brüder - Mantel, H: Brüder - A Place of Greater Safety
gefunden, dachte er, nichts auf der Welt kann befriedigender sein als ein kunstreich platziertes Semikolon. Sobald er Papier und Tinte in Reichweite hatte, war es zwecklos, an seine besseren Instinkte zu appellieren, ihm vorzuhalten, dass er Rufe ruinierte, Leben zerstörte. Ein süßes Gift rann ihm dann durch die Adern, weicher als der edelste Cognac und auch schneller zu Kopfe steigend. Und so wie manche Menschen süchtig nach Opium sind, war er süchtig nach Gelegenheiten, seine hohe Kunst des Verspottens, Verunglimpfens und Verhöhnens zu üben; Laudanum mochte die Sinne beruhigen, aber ein guter Leitartikel brachte den Atem zum Stocken und den Puls zum Rasen. Schreiben war wie bergab rennen: zu bremsen fiel schwer, selbst wenn man es wollte.
Ein paar unschöne Intrigen runden das annus mirabilis ab. Lafayette teilt dem Herzog von Orléans mit, dass er nach Beweisen für seine Verstrickung in die Oktoberunruhen sucht und ihn, wenn er sie findet … belangen wird. Der General will den Herzog außer Landes wissen; Mirabeau, dessen Pläne mit Philippe stehen und fallen, braucht ihn in Paris. »Sagen Sie mir, wer Sie unter Druck setzt«, beschwört ihn Mirabeau; nicht, dass er es nicht erraten könnte.
Der Herzog ist verwirrt. Eigentlich sollte er längst König sein, aber er ist es nicht. »Da ist man der, der alles ins Rollen bringt«, beklagt er sich bei de Sillery, »und andere nehmen es einem aus der Hand.«
Charles-Alexis ist voller Mitgefühl: »Nein, Segeln am Wind sieht anders aus.«
»Bitte«, sagt der Herzog. »Ich bin heute nicht in der Stimmung für Seefahrtsmetaphern.«
Der Herzog hat Angst – Angst vor Mirabeau, Angst vor Lafayette, wobei er sich vor Letzterem eine Spur mehr fürchtet. Sogar vor dem Abgeordneten Robespierre hat er Angst, der sich in der Versammlung gegen alle und alles stellt, ohne je die Stimme zu heben oder die Beherrschung zu verlieren, seine sanften Augen unerbittlich hinter den Brillengläsern.
Nach den Vorfällen des Oktober entwirft Mirabeau einen Plan, der königlichen Familie zur Flucht zu verhelfen – denn »Flucht« ist das Wort, das nun am Platze ist. Die Königin verabscheut ihn, aber er versucht die Lage so hinzudrehen, dass er bei Hof als unverzichtbar erscheint. Er hasst Lafayette, erhofft sich aber einen gewissen Nutzen von ihm; der General hat seine Finger am Geldsäckel der Geheimpolizei, und das ist kein geringer Vorteil, wenn man ein großes Haus führen, seine Sekretäre entlohnen und bedürftigen jungen Männern unter die Arme greifen muss, die einem ihre Talente zur Verfügung stellen.
»Sie bezahlen mich zwar«, sagt der Comte, »aber gekauft haben sie mich nicht. Wenn irgendwer mir vertrauen würde, bräuchte ich nicht mit so vielen Finten zu arbeiten.«
»Ja, Monsieur«, sagt Teutch steinern. »Ich an Ihrer Stelle würde mit diesem Spruch nicht hausieren gehen, Monsieur.«
General Lafayette gab sich derweil düsteren Gedanken hin. »Mirabeau«, sagte er kalt, »ist ein Scharlatan. Wenn ich es darauf anlegen würde, seine Ränke aufzudecken, stünde ihm das Wasser bis zum Hals. Die Vorstellung, ihn in der Regierung zu haben, ist unerträglich. Er ist durch und durch korrupt. Unfasslich, wie seine Beliebtheit sich hält. Aber sie wächst ja eher noch. Doch, sie wächst. Ich muss ihm einen Posten anbieten, eine Botschaft irgendwo, dann ist er wenigstens außer Landes …« Lafayette fuhr sich durch das spärliche blonde Haar. Sein einziger Trost war, dass Mirabeau einmal – und zwar in aller Öffentlichkeit – bemerkt hatte, er würde Philippe nicht einmal als Kammerdiener einstellen. Denn wenn diese beiden gemeinsame Sache machten … nein, das ist undenkbar. Orléans muss Frankreich verlassen, Mirabeau muss gekauft werden, der König muss Tag und Nacht von sechs Nationalgardisten bewacht werden, die Königin ebenso, heute Abend speise ich mit Mirabeau und biete ihm … Dieses Letzte sagte er nur in Gedanken. Es war gleichgültig, wo seine Sätze begannen und endeten, denn er sprach ohnehin mit sich selbst – wem außer sich selbst konnte er trauen? Flüchtig sah er in den Spiegel, auf das schmale, helle Gesicht und den nach hinten wandernden Haaransatz, über den die Pamphletisten der Cordeliers so gern spotteten; dann verließ er mit einem Seufzer das leere Zimmer.
Comte de Mirabeau an Comte de la Marck:
Gestern spätabends Lafayette getroffen. Er nannte Ort und Betrag; ich lehnte ab; lieber wolle ich schriftlich die erste größere Botschaft
Weitere Kostenlose Bücher