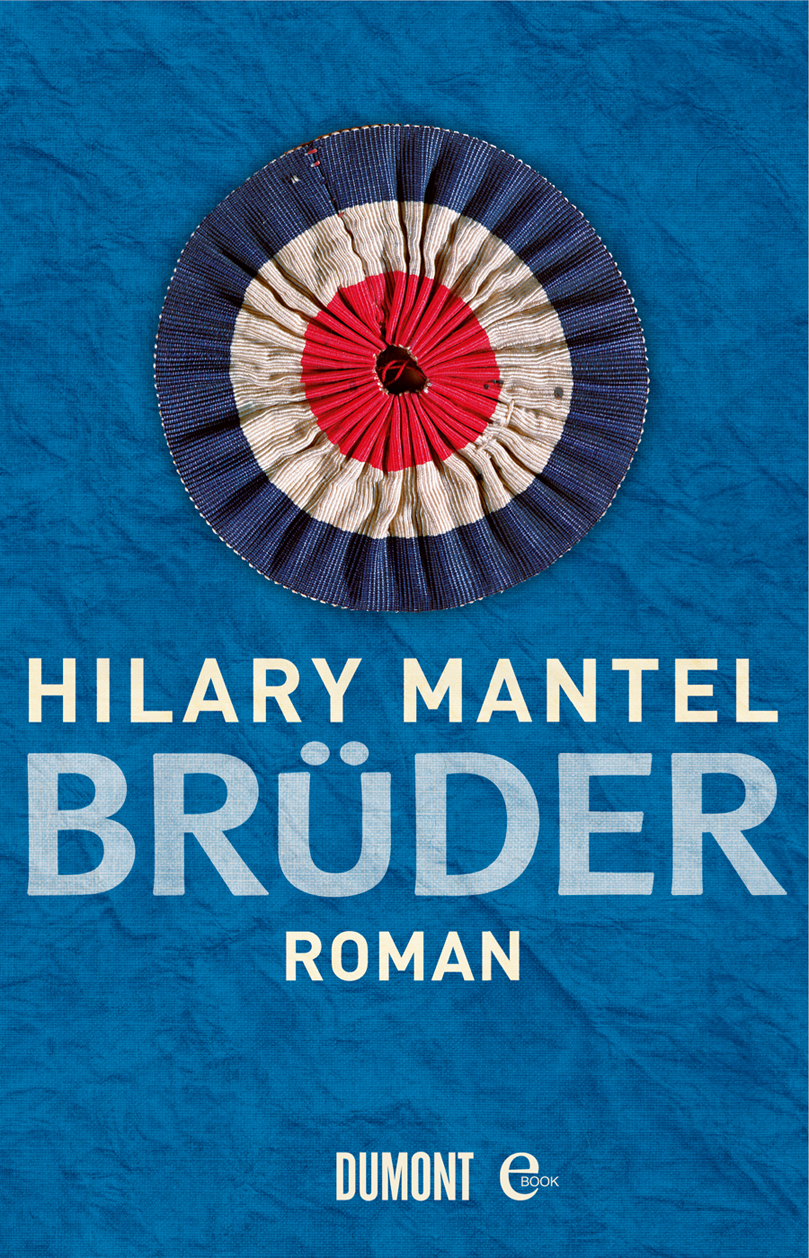![Brüder - Mantel, H: Brüder - A Place of Greater Safety]()
Brüder - Mantel, H: Brüder - A Place of Greater Safety
nichts zu bereden gibt. Erst lungern sie nachmittags auf den Märkten herum, weil dort übrig gebliebenes Brot gegen Abend billig verkauft oder verschenkt wird, aber die ruppigen, kämpferischen Pariser Hausfrauen sind schneller als sie. Später gibt es ab Mittag überhaupt kein Brot mehr. Sie hören, dass der gute Herzog von Orléans Tausende von Laiben an Menschen verteilt, die nichts haben, wie sie. Aber die Pariser Bettler mit ihren spitzen Ellbogen kommen ihnen auch hier zuvor – skrupellos schicken sie sie in die Irre, stoßen sie um, trampeln über sie hinweg. Sie drängen sich in Hinterhöfen zusammen, unter Kirchenportalen, überall, wo der schneidende Wind nicht hinkommt. Die ganz Jungen und die ganz Alten werden von den Spitälern aufgenommen. Geplagte Mönche und Nonnen versuchen Bettzeug und frisches Brot für sie aufzutreiben, aber es gibt nur schmutzige Laken und tagealtes Brot. Die Wege des Herrn sind wundersam, sagen sie, denn würde es wärmer, brächen sofort Seuchen aus. Frauen schluchzen vor Angst, wenn sie gebären.
Selbst die Reichen kommen ein wenig aus dem Tritt. Almosen genügen nicht mehr; auf vornehmen Straßen liegen Erfrorene herum. Wer aus seiner Kutsche steigt, rafft den Umhang vors Gesicht, um seine Wangen gegen die brennende Kälte abzuschirmen und die Augen gegen den bedrückenden Anblick.
»Du willst zu den Wahlen nach Hause , Camille?«, fragte Fabre. »Wie kannst du mir das antun? Was wird aus unserem großen Roman?«
»Stell dich nicht so an«, befahl ihm Camille. »Wenn ich zurückkomme, müssen wir unser Dasein vielleicht nicht mehr mit Pornographie fristen. Dann haben wir andere Einkommensquellen.«
Fabre grinste. »Camille verwechselt die Wahlen mit einer Goldgrube. Du gefällst mir sehr dieser Tage, Camille, du bist so klapprig und wild, du redest wie jemand aus einem Buch. Hast du zufällig schon Schwindsucht? Brütest du ein Fieber aus?« Er legte Camille die Hand auf die Stirn. »Hältst du überhaupt durch bis zum Mai?«
Wenn Camille morgens aufwachte, wollte er sich nur noch unter der Decke verkriechen. Er hatte immerzu Kopfschmerzen und verstand nur die Hälfte von dem, was die Leute zu ihm sagten.
Zwei Dinge – die Revolution und Lucile – schienen ferner denn je zu sein. Er wusste, dass eins das andere bedingen würde. Er hatte sie vor einer Woche das letzte Mal gesehen, ganz kurz nur, und da hatte sie kühl gewirkt: »Ich will nicht kühl wirken«, hatte sie mit einem schmerzlichen Lächeln gesagt, »aber ich darf mir meinen Schmerz nicht anmerken lassen.«
In seinen ruhigeren Momenten sprach er von friedlichen Reformen – bekannte sich zu einer republikanischen Gesinnung, schob aber nach, dass er nichts gegen Louis habe, dass er ihn für einen anständigen Menschen halte. Er redete genauso wie alle anderen. Aber d’Anton sagte: »Ich kenne dich, du willst Gewalt, du findest Geschmack daran.«
Er ging zu Claude Duplessis und eröffnete ihm, dass sein Auskommen gesichert sei: Selbst wenn ihn die Picardie nicht als Abgeordneten entsandte (er tat so, als rechnete er fest damit), würden sie ganz gewiss seinen Vater entsenden. Claude sagte: »Ich weiß nicht, was Ihr Vater für ein Mensch ist, aber wenn er einen Funken Verstand hat, verleugnet er Sie, solange er in Versailles ist, um nicht durch Sie kompromittiert zu werden.« Sein Blick, der einen Punkt irgendwo oben an der Wand fixiert hatte, senkte sich hinab zu Camilles Gesicht – ein Abstieg, den er sichtlich als solchen empfand. »Ein Schreiberling jetzt also«, sagte er. »Meine Tochter ist ein versponnenes Mädchen, idealistisch und voller Unschuld. Sie kennt keine Mühsal, keine Sorgen. Sie glaubt vielleicht, sie wüsste, was sie will, aber sie weiß es nicht; ich weiß es.«
Er ließ Claude stehen. Sie sollten sich mehrere Monate nicht mehr begegnen. Er stand in der Rue Condé und sah hinauf zu den Fenstern dort, um vielleicht einen Blick auf Annette zu erhaschen. Aber er sah niemanden. Erneut klapperte er die Verleger ab, von denen er sich etwas erhoffte, als könnten sie – seit letzter Woche – all ihre Bedenken über Bord geworfen haben. Die Druckerpressen liefen Tag und Nacht, und ihre Besitzer wägten das Risiko ab; aufrührerische Literatur war gefragt, aber niemand konnte es sich leisten, seine Pressen beschlagnahmt und seine Arbeiter abgeführt zu sehen. »Ganz einfach – wenn ich das hier drucke, wandere ich ins Gefängnis«, hatte der Drucker Momoro gesagt. »Können Sie es nicht
Weitere Kostenlose Bücher