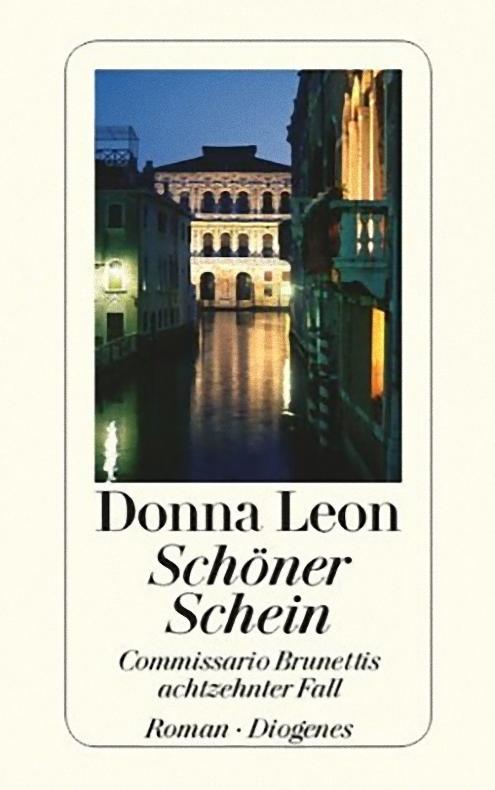![Brunetti 18 - Schöner Schein]()
Brunetti 18 - Schöner Schein
musste ein Mann sich kaum noch anstrengen, um für ehrlich gehalten zu werden.
»... er Römer wäre, würde er allgemein als Ehrenmann gelten«, schloss sie, und Brunetti hatte wenig Mühe, den Rest zu rekonstruieren, den er, in seine eigenen Gedanken versunken, nicht mitbekommen hatte.
»Signora«, sagte er und nahm sich vor, einen möglichst unpersönlichen Ton anzuschlagen, »ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Ihnen behilflich sein kann.« Er lächelte, um seinen guten Willen zu bekunden. »Es würde mir unendlich weiterhelfen, wenn Sie mir erklären könnten, was genau Ihnen solche Sorgen bereitet.«
Sie hob gedankenverloren die rechte Hand und rieb sich die Stirn. Dabei starrte sie aus dem Fenster, und Brunetti registrierte mit einem gewissen Unbehagen die weißen Streifen, die ihre Finger auf der Haut zurückließen. Zu seiner Überraschung stand sie plötzlich auf, trat ans Fenster und fragte, ohne ihn anzusehen: »Das ist San Lorenzo, oder?«
»Ja.«
Sie blickte weiter über den Kanal nach der seit Ewigkeiten nicht restaurierten Kirche. Schließlich sagte sie: »Er wurde auf einen glühenden Rost gelegt und gemartert, richtig? Soweit ich weiß, hat man von ihm verlangt, seinem Glauben abzuschwören.«
»So will es die Überlieferung«, antwortete Brunetti.
Sie drehte sich um, kam wieder auf ihn zu und sagte: »So viel haben sie gelitten, diese Christen. Das hat ihnen sehr gefallen, sie konnten gar nicht genug davon bekommen.« Sie setzte sich und sah ihn an. »Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum ich die Römer so sehr bewundere. Die haben nicht gern gelitten. Das Sterben hat ihnen offenbar nichts ausgemacht, das haben sie aufrecht hingenommen. Aber Schmerzen - zumindest wenn sie selbst sie zu erleiden hatten - waren nicht nach ihrem Geschmack, das war bei den Christen ganz anders.«
»Sind Sie mit Cicero fertig und befassen sich jetzt mit der christlichen Epoche?«, fragte er ironisch, um sie vielleicht etwas aufzuheitern.
»Nein«, sagte sie, »die Christen interessieren mich nicht besonders. Wie gesagt, die haben mir zu gern gelitten.« Sie verstummte, sah ihm lange unbeirrt in die Augen und sagte: »Zur Zeit lese ich Ovids Fasti. Zum ersten Mal, früher hatte ich keinen Grund dazu.« Dann, mit besonderem Nachdruck, als fühle sie sich dazu gedrängt und wolle Brunetti veranlassen, jetzt gleich nach Hause zu gehen und mit der Lektüre anzufangen, fügte sie hinzu: »Buch zwei. Da steht alles drin.«
Brunetti erwiderte lächelnd: »Es ist so lange her, dass ich mich nicht einmal erinnere, ob ich es wirklich gelesen habe. Verzeihen Sie mir.« Etwas Besseres fiel ihm nicht ein.
»Oh, da gibt es nichts zu verzeihen, Commissario, wenn man das nicht gelesen hat«, sagte sie mit der Andeutung eines Lächelns. Dann plötzlich mit veränderter Stimme und wieder starrer Miene: »In den Fasti wird auch nichts verziehen.« Wieder so ein langer Blick. »Vielleicht sollten Sie das Buch einmal lesen.«
Ohne Übergang, als habe dieser Exkurs in die römische Kultur nicht stattgefunden oder als habe sie seine wachsende Unruhe bemerkt, fuhr sie fort: »Ich habe Angst vor einer Entführung.« Sie nickte ein paar Mal, wie um das zu bestätigen. »Ich weiß, das ist dumm, und ich weiß auch, dass so etwas in Venedig nie geschieht, aber eine andere Erklärung habe ich nicht. Jemand könnte das getan haben, um herauszufinden, wie viel Maurizio bezahlen könnte.«
»Wenn Sie entführt würden?«
Ihre Überraschung war vollkommen echt. »Wer sollte mich denn entführen?« Als hörte sie sich selbst, fügte sie hastig hinzu: »Ich dachte an Matteo, seinen Sohn. Er ist der Erbe.« Und mit einem Achselzucken, als habe sie selbst nichts zu bedeuten, fuhr sie fort: »Oder auch seine Exfrau. Sie ist sehr reich und besitzt eine Villa auf dem Land, in der Nähe von Treviso.«
Brunetti antwortete leichthin: »Das hört sich an, als hätten Sie schon viel darüber nachgedacht, Signora.«
»Das habe ich auch. Aber ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich weiß überhaupt nicht weiter. Deswegen bin ich zu Ihnen gekommen, Commissario.«
»Weil das mein Fachgebiet ist?«, fragte er lächelnd.
Immerhin löste sein Tonfall ihre zunehmende Spannung. Sie wurde merklich ruhiger. »So könnte man es vielleicht ausdrücken«, sagte sie und lachte sogar ein wenig. »Vielleicht brauche ich jemanden, dem ich vertrauen kann und der mir sagt, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauche.«
Jetzt hatte sie die Bitte
Weitere Kostenlose Bücher