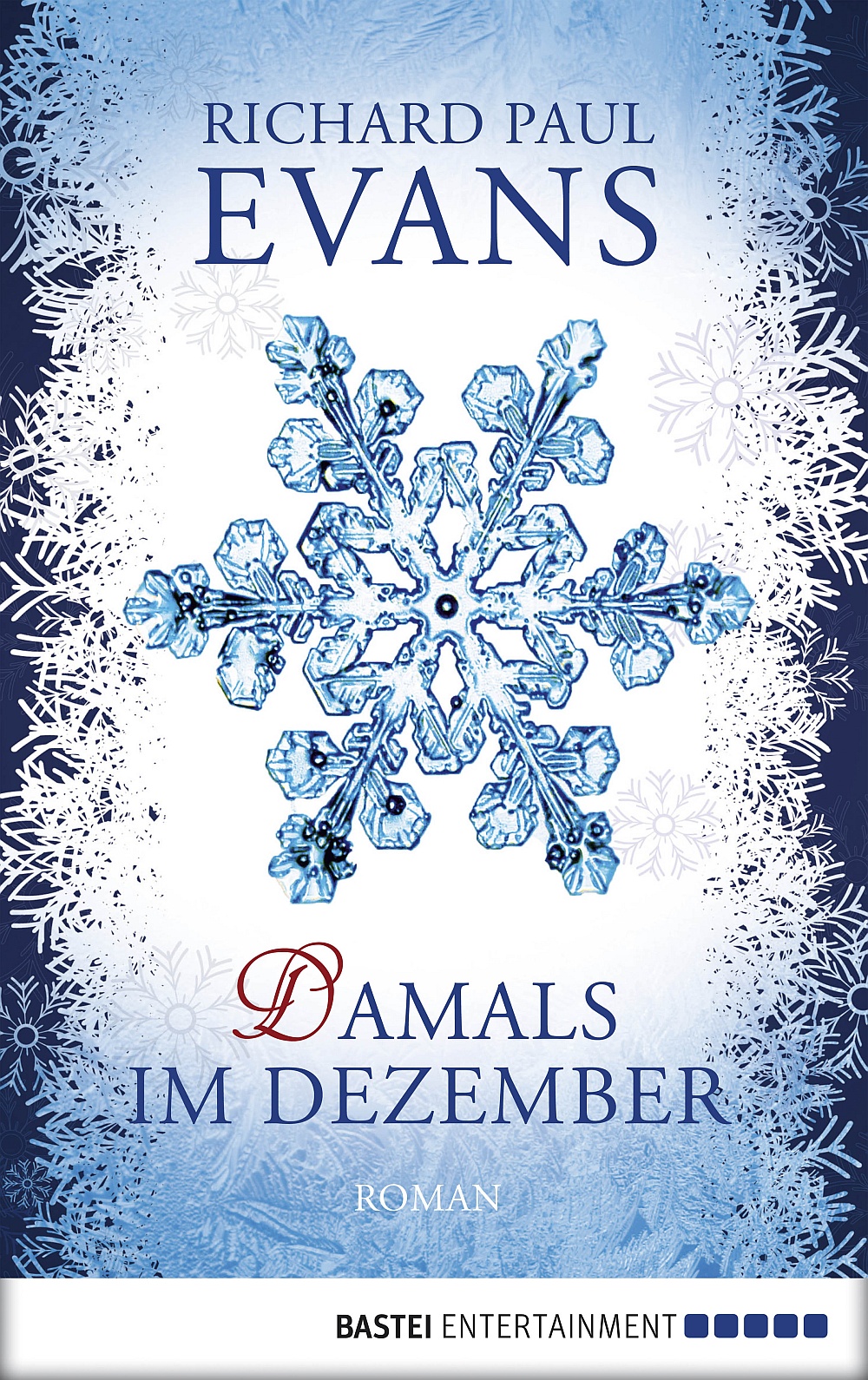![Damals im Dezember]()
Damals im Dezember
in einer Krise hätte wenden können, war James. Und der war tot.
Was die Familie betraf, so befand ich mich in einer ebenso schlechten Lage. Meine Großeltern waren alle bereits vor Jahren gestorben. Die einzigen Verwandten, die ich mütterlicherseits hatte, lebten ganz im Osten, und das letzte Mal, dass ich jemanden von ihnen gesehen hatte, war auf der Beerdigung meiner Mutter gewesen, als ich sieben war. Einer Familie am nächsten kam noch die Truppe, die mein Vater um sich geschart hatte: Henry, der mir einen Tritt gegeben hatte, Mary, die meinem Vater völlig ergeben war und nichts ohne seine Zustimmung tun würde, sowie meine Tante Barbara und Onkel Paul. Ich kannte Barbara und Paul gut genug, um zu wissen, dass sie sich auf die Seite meines Vaters stellen würden.
So schrecklich es auch klang: Die Nacht im Obdachlosenheim zu verbringen, schien die beste Möglichkeit zu sein, bis ich die Dinge geklärt hatte.
Am Nachmittag machte ich mich auf den Weg zur Rettungsmission. Sie war leicht zu finden, weil vor dem Gebäude eine große Menschenmenge wartete. Ich fühlte mich unbehaglich, als ich dort ankam. Manche der Wartenden waren offensichtlich geisteskrank und sprachen mit sich selbst, manche zitterten, weil sie nach irgendeiner Droge süchtig waren, wieder andere waren einfach vom Glück verlassene Menschen wie ich. Menschen wie ich? Ich bezweifelte, dass sich in der Menge viele gefallene Millionäre befanden.
Ich drängte mich nach vorn und sah mich nach jemandem um, der mir erklären konnte, wie die Dinge hier funktionierten. Daraufhin schrie mich eine Frau an: »Hinten anstellen!« Sie zeigte auf mich, und fast alle drehten sich nach mir um und sahen mich an. Auf mich aufmerksam zu machen, war das Letzte, was ich wollte.
Ein großer, mit Tattoos bedeckter Mann stieß mich an. »Stell dich in die Schlange.«
»Ich suche die Schlange ja gerade«, sagte ich.
Einen Augenblick später hob ein Mann an der Tür zur Unterkunft die Hand und rief: »Das war’s. Das war’s.«
Ich drehte mich zu dem Mann hinter mir um. Er trug einen Arbeitsanzug der Armee und hatte graue, zu einem Pferdeschwanz zurückgebundene Haare. »Wovon spricht er?«, fragte ich.
»Sie sind belegt«, antwortete er.
»Und was machen wir nun?«
Er sah mich amüsiert an. »Irgendwo einen schönen Müllcontainer finden, der nicht zu sehr stinkt, und uns vorher vergewissern, dass nicht gerade Müllabfuhr ist. Auf die Art hab ich nämlich einen Kumpel verloren.«
»Ich schlafe nicht in einem Müllcontainer«, sagte ich.
»Wie du willst«, meinte er. »Es gibt immer noch die Tunnel.«
»Was sind die Tunnel?«
»Die Entwässerungstunnel unter der Stadt. Es gibt da unterirdisch eine ganze Welt.«
»Wo findet man sie?«
Er grinste. »Sie sind überall, mein Freund. Direkt unter dir ist einer. Aber du brauchst eine Taschenlampe und ein Messer.«
»Warum ein Messer?«
»Man weiß nie, wer einem da unten begegnet.«
***
Meine Welt hatte sich von einem Traum in einen Albtraum verwandelt. Ich bin nicht so wie diese Leute, sagte ich mir, wie diese Obdachlosen. Ich habe ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen geleitet. Ich habe einen MBA von der Wharton. Ich habe im Haus von Napoleon gewohnt.
Doch diese Gedanken trösteten mich nicht. Nein, ich war nicht wie sie, nicht so schlau. Wenn sie so viel Geld hätten, würden sie sich daran klammern wie an eine Rettungsinsel. Sie würden Sean keinen Cent geben.
Ich lief bis zwei Uhr morgens in der Gegend herum – bis ich nicht mehr konnte. Ich war versucht, das Geld, das ich in meiner Tasche hatte, für ein billiges Hotelzimmer auszugeben, aber das wäre kurzsichtig gewesen. Von was sollte ich dann essen? Hinter einem Feuerdornbusch in einem Park fand ich einen Platz zum Schlafen. Allerdings schlief ich nicht wirklich, sondern fuhr bei jedem Geräusch hoch. Obdachlos zu sein ist furchteinflößend.
Vor Jahren im Soziologieunterricht am College fragte uns der Professor, wie es wohl wäre, ohne Obdach, Freunde oder Geld in einem fremden Land ausgesetzt zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich Gelegenheit bekommen würde, es am eigenen Leibe zu erfahren. Im Laufe der nächsten Tage lernte ich diese Kultur kennen, von der ich jetzt ein Teil war. Ich war erstaunt, wie unbehaglich sich »normale« Leute in meiner Nähe fühlten, und bemerkte ihre verstohlenen, mitleidigen oder geringschätzigen Blicke.
Ich erfuhr, dass es über vierzehntausend Obdachlose in der Stadt gab, denen nur eine kleine Anzahl
Weitere Kostenlose Bücher