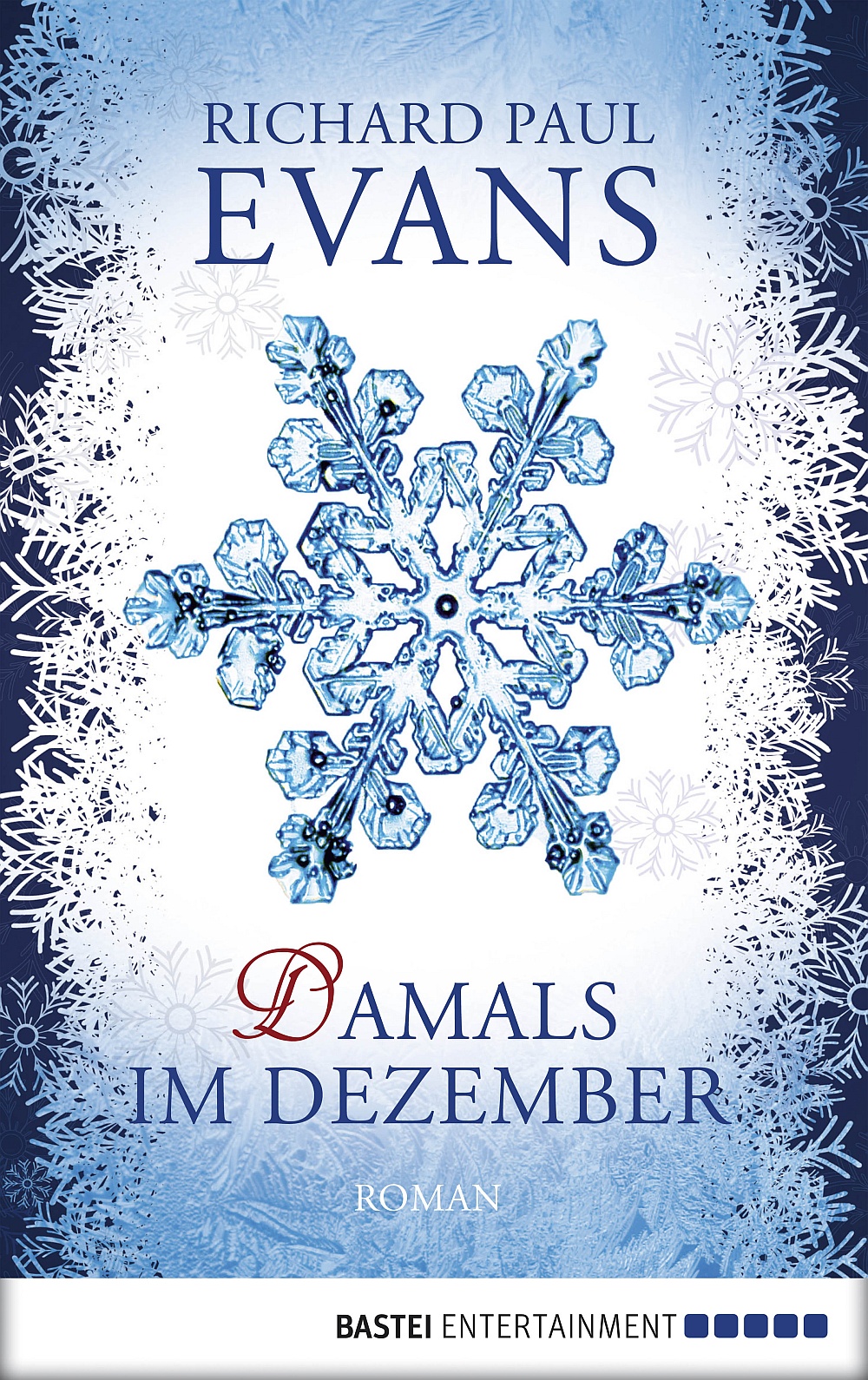![Damals im Dezember]()
Damals im Dezember
dahin.
Das Wetter wurde kälter, aber nicht unerträglich. Ich vermute, dass der milde Winter einer der Gründe ist, warum Las Vegas so viele Obdachlose anzieht – zumindest diejenigen, die es nicht selbst erzeugt. Wenn ich mich nur einen Staat nördlicher aufgehalten hätte, wäre ich möglicherweise erfroren.
Ich wurde deprimierter und damit zugleich auch nachtaktiver. Normalerweise begann ich meinen Tag nun um vier Uhr nachmittags, aß in der Suppenküche zu Abend und wanderte dann nachts herum. Mir war die Welt nachts lieber, wenn sie weniger bevölkert war, normale Leute schliefen und sie uns, den Unsichtbaren, überlassen wurde. Außer denken tat ich nicht viel. Das war alles, was mir zu tun blieb, nachdenken und herumlaufen.
Eines Nachts wurde ich beim Überqueren eines Parkplatzes vor einem Heimwerkermarkt von zwei Männern angegriffen. Ich lief nicht weg, weil ich sie gar nicht kommen sah. Sie schlugen mich sofort zu Boden.
Im Rückblick war das Bestürzendste an dem Überfall die leise, ruhig Art, wie er geschah – zwei Jäger, die ihre Beute einkreisen. Man merkte ihnen keine Gewissensbisse, kein Schuldgefühl, keine Gnade an, sondern nur die schweigende Überzeugung, dass es in der Natur eben so zugeht: blutig. Obdachlos zu sein ist entmenschlichend, aber ich glaube, dass ich erst da begriff, wie sehr ich zum Tier geworden war.
Beide Männer hatten Messer. Ich hatte ebenfalls eins, aber mein Instinkt sagte mir, dass es mein sicherer Tod wäre, wenn ich es einsetzte. Vielleicht würde ich ohnehin sterben, aber vielleicht auch nicht. Ehrlich gesagt, war mir das auch weitgehend gleichgültig.
Der gesamte Vorfall glich einer außerkörperlichen Erfahrung, die rings um mich aufblitzte wie Bilder im Licht eines Stroboskops – Blut- und Schweißspritzer, eine Faust oder ein Schuh, denen ein plötzlicher Schmerz folgte. Doch selbst in meiner Verzweiflung und Angst arbeitete mein Verstand weiter. Ich fragte mich, was mein Vater denken würde, wenn er erfuhr, dass sein einziger Sohn als Obdachloser gestorben war. Würde es in den Zeitungen stehen? Dem Wall Street Journal? Vielleicht. Es war eine gute Story: Sohn eines Multimillionärs obdachlos und ermordet aufgefunden. Vielleicht fiel dann sogar der Aktienkurs von Crisp’s.
Die Medien würden vermutlich meinem Vater die Schuld geben – die Öffentlichkeit sucht immer nach einem Sündenbock –, aber ich wusste es besser. Ich hatte mir das alles selbst eingebrockt. Ich konnte Sean, dem System, dem Schicksal oder sogar Gott die Schuld geben, aber am Ende musste ich eingestehen, dass ich diesen Pfad in dem Moment betrat, in dem ich mich von meinem Vater abwandte. Es war meine Entscheidung gewesen. Mir gefiel mein Ziel möglicherweise nicht, aber ich hatte den Pfad ausgewählt.
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Ich habe gelernt, dass wirkliche Engel keine hauchdünnen weißen Gewänder tragen und eine samtweiche Haut haben. Vielmehr sind ihre Hände voller Schwielen, und sie riechen nach Schweiß.
Aus dem Tagebuch von Luke Crisp
Ich wurde bewusstlos geschlagen. Mir wurde alles abgenommen außer meinen Boxershorts und meinem Leben, die ich jetzt als gleichwertig betrachtete. Ich erwachte in einer Wasserpfütze, aber nicht in einer Blutlache. Meine Nase blutete, aber das war alles. Sie hatten mich nicht aufgeschlitzt und nicht getötet. Mein Rucksack war verschwunden, mein letztes Geld ebenfalls. Die Straße hatte über mich gesiegt.
Während ich so dalag und allmählich wieder zu mir kam, tauchten Scheinwerfer auf. Ich war schutzlos und hatte mich wie ein Embryo zusammengerollt. Das Fahrzeug fuhr dicht an mich heran. Wegen des erlittenen Traumas bebte ich am ganzen Körper. Ein Mann stieg aus einem Transporter, und neues Entsetzen überkam mich. »Was will er von mir?«, dachte ich. »Was wird er mir antun?«
Der Mann kniete neben mir nieder. »Alles in Ordnung mit dir, Bruder?«
Ich sah zu ihm hoch. Durch einen Nebel aus Schmerz und Angst sah ich einen kleinen, stämmigen Hispano, der schätzungsweise Mitte oder Ende fünfzig war. Seine Augen waren dunkel wie Kohle, und auf seiner rechten Wange hatte er eine breite Narbe, die aussah wie ein Brandmal.
»Ich bin verletzt«, sagte ich.
»Glaubst du, dass du aufstehen kannst?«
»Ich weiß nicht.«
»Ich werde dir helfen.«
Als ich mich zwang, mich auf meinen Knien aufzurichten, stöhnte ich auf. Er nahm meinen Arm und half mir auf die Füße. Als ich stand, schoss mir ein stechender Schmerz durch den
Weitere Kostenlose Bücher