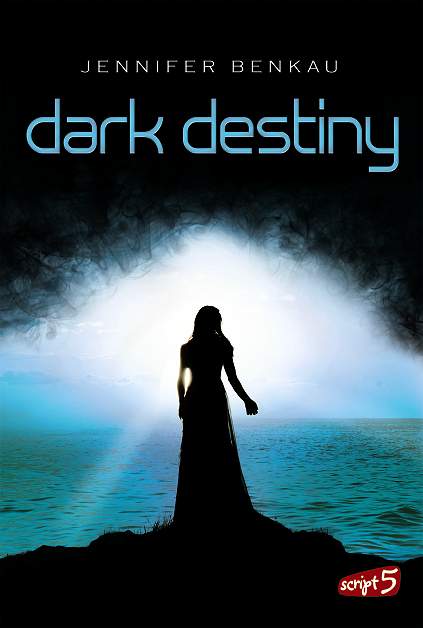![dark destiny]()
dark destiny
den Magen.
»Er war am Leben.«
»Ja, aber viel mehr auch nicht.« Ich versuchte, die Erinnerungen nicht an mich heranzulassen, denn ich wollte nicht erneut in Tränen ausbrechen. Es war genug. Ich musste lernen zu akzeptieren, dass Neel tot war.
»Und du weißt wirklich nicht ...«, fragte ich vorsichtig, »wie es passiert ist?«
Matthial zuckte mit den Schultern und in mir schoss vollkommen unvorbereitet eine Mordswut hoch. Das Tier hinter der Ascheschicht grollte. »Sie werden dir etwas gesagt haben! Du willst mir doch nicht erzählen, dass du noch nicht mal gefragt hast, wie es dazu gekommen ist!«
»Ich weiß es nicht. Ich wollte es nicht wissen.«
Nein. Matthial wollte es mir nur nicht sagen.
Ich biss die Zähne zusammen. Plötzlich brauchte ich nichts so sehr wie Antworten auf diese eine Frage: Wie war Neel gestorben?
Ich malte mir in bunten Bildern aus, er wäre im Kampf gefallen, genau so, wie er es sich gewünscht hatte. Die Vorstellung, er könnte auf dem Karren unter der Decke einfach die Augen geschlossen und nicht mehr aufbekommen haben, war unerträglich. Man kann an infizierten Wunden sterben ... Ich musste daran denken, wie sich im Sommer meine Hand entzündet hatte. Der süßliche Geruch von krankem Fleisch erfüllte meine Nase. Ich hätte Neels Wunden versorgen müssen!
Frische Hinterlassenschaften von Pferden dicht neben dem Straßengraben bannten unsere Aufmerksamkeit. Ich stieß einen Apfel mit der Stiefelspitze an und betastete ihn, um sicherzugehen. Er war kalt, aber noch nicht gefroren, die Reiter waren erst kürzlich diesen Weg geritten.
»Percents«, vermutete Matthial und sah sich aufmerksam um.
Mein Gefühl sagte etwas anderes. Ich kannte die Percents und ihre Gewohnheiten. »Die reiten auf der Straße. Ihre Pferde sind beschlagen, der Asphalt schadet ihnen nicht. Und ihre Reiter müssen keine Angst haben, dass jemand den Hufschlag hört.« Außerdem hatte dieses Pferd hier überwiegend Gras gefressen. Percent-Pferde standen dagegen normalerweise in Ställen. Matthial sagte ich davon nichts.
Ich hatte gesehen, wohin es führte, wenn man zu viel wusste. Und ich wusste so viel mehr über den Alltag der Percents, als Matthial ahnte. Ich wollte ganz sicher nicht seinen strategischen Berater spielen müssen. Kaum war der Gedanke gedacht, schämte ich mich ein bisschen dafür. Nun übertrieb ich. Matthial würde nicht versuchen, etwas aus mir herauszupressen. Allein die Vorstellung, ein Percent hätte mir empfindliche Informationen zukommen lassen können, ging viel zu weit über Matthials Horizont hinaus. Das verlieh mir Mut. Das sowie die Pferdespuren. Denn wenn es keine Per-cent-Pferde gewesen waren und nicht unsere, dann mussten sie zu Jamies Clan gehören. Und dort versteckte sich die Antwort auf meine Frage.
»Ich habe es mir anders überlegt«, sagte ich. Es musste das Tageslicht sein, das mir eine Entschlusskraft verlieh, die ich in den letzten Wochen so vermisst hatte.
Matthial wirkte erleichtert. Ich sprach rasch weiter, ehe er etwas sagen konnte.
»Ich bleibe vielleicht nicht über den Winter.«
»Das ist doch Blödsinn, Joy. Den Winter überlebst du allein nicht.«
Er nahm mich nicht ernst. Definitiv nicht.
»Wer sagt, dass ich allein bleibe?«
»Du willst zu Jamie?« Hörte ich da eine Spur Hohn heraus?
Mir war klar, dass er das annahm. Zu Mars würde ich sicher nicht gehen, auch wenn meine Schwester mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Kind bei ihm lebte. Aber wie konnte Matthial so sicher sein, dass ich nicht doch in die Stadt ging?
»Jamie«, fuhr er fort, »nimmt keine neuen Clanmitglieder auf. Vor allem nicht im Winter. Er hat genug Leute. Und wenn er jemanden aufnehmen will, kommt er auf dich zu. Dich ihm anzubieten, lässt dich höchstens in seiner Achtung sinken. Jamies Waldleute sind stolz, Joy. Besudle nicht unsere Ehre, indem du zu ihm gehst und bettelst.«
Es mochte sein, dass er übertrieb oder log, um mich von meinem Vorhaben abzuhalten. Aber Matthial war immer ein guter Redner gewesen, und auch wenn ich mich dafür verfluchte, so konnte ich doch nicht verhindern, dass seine Worte Eindruck auf mich machten.
»Bleibt ja noch die Stadt. In der Stadt liegt eine Marke für dich, ich weiß. Du würdest dort ein Bett finden, mit viel Glück sogar ein eigenes Zimmer. Aber auch in der Stadt ist Winter. Alle guten Arbeiten sind längst verteilt. Bleiben die, die niemand machen will.«
Bedauerlicherweise lag er auch damit nicht falsch. Im Winter an ein Tor
Weitere Kostenlose Bücher