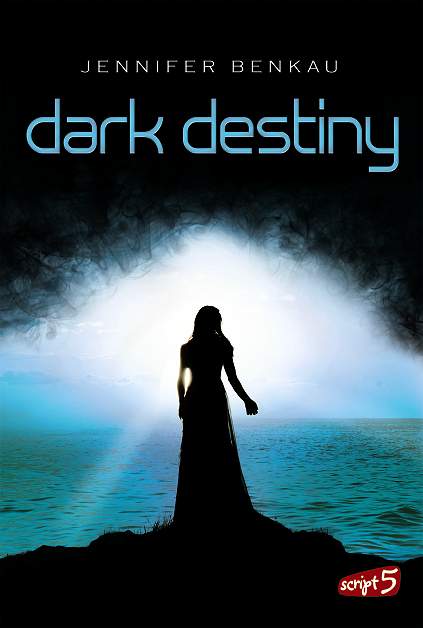![dark destiny]()
dark destiny
gegangen. Schuldgefühle stiegen wie Galle in meiner Kehle hoch und verätzten mir den Mund. Ich hätte ihn nicht laufen lassen dürfen. Alles wäre besser gewesen, als ihn den Ratten auszuliefern. Ich hätte ihn besser erlösen sollen, statt zuzulassen, dass die kleinen Monster ihn zu Tode hetzten und ihn bei lebendigem Leib auffraßen.
Ich richtete mich mühsam auf und zog die Decke eng vor meiner Brust zusammen - Kälte und Erschöpfung ließen mich zittern.
Die Frau lächelte mich an. »Essen«, sagte sie und hielt eine Rattenkeule hoch. »Später Essen. Fleisch.«
Ich erwiderte ihr Lächeln, auch wenn es vermutlich trübe geriet. Wie gerne hätte ich geschlafen. Der Hunger hatte nachgelassen und war einem bösen Widerwillen gewichen. Die Vorstellung, etwas zu essen - egal was -, schien mir plötzlich abwegig. Doch mir war klar, dass es wichtig war. Ich versuchte, mir die blutigen Klumpen, die die Frau in den schmutzigen Händen hielt, knusprig gebraten vorzustellen.
Der Mann trat zu uns. Erstmals sah ich ihn aus der Nähe und erschrak prompt. Er war viel jünger, als ich zunächst gedacht hatte, höchstens Mitte zwanzig, doch auch ihn ließ der Schmutz im Gesicht wesentlich älter wirken. Er roch ebenso übel wie die Frau, aber was beklagte ich mich - ich roch nach den letzten beiden Tagen unter Garantie nicht besser.
Sie sahen sich ähnlich, meine beiden Retter. Ihre Augen hatten die gleiche, ungewöhnliche Farbe - ein helles, fast gelblich erscheinendes Braun, das in den schmutzigen Gesichtern leuchtete wie poliertes Gold in einem Haufen Kohlen. Auch ihre Nasen waren auf die gleiche Weise geschwungen und beide hatten einen auffälligen, zur Stirn spitz zulaufenden Haaransatz.
Geschwister. Ich hatte sie zunächst für ein Paar gehalten, aber sie waren offensichtlich Bruder und Schwester. Die Erkenntnis kitzelte eine Erinnerung in mir wach, die ich fast vergessen hatte.
Vor vielen Jahren, ich mochte gerade zehn Jahre alt gewesen sein, vielleicht noch jünger, war eine Familie zu unserem Clan gekommen. Ich erinnerte mich bloß noch an die Kinder, weil sie so scheu schienen, so wild und wortlos, und weil ein Streit um sie entbrannte. Mars wollte die Eltern fortschicken. Es waren Clanfreie, die sich ihm zuvor nicht hatten unterwerfen wollen, nun aber in Schwierigkeiten geraten waren. Mars hatte ihnen nicht helfen, aber die Kinder aufnehmen wollen. Doch die Familie war eng zusammengewachsen, sie hatten Mars' Angebot als Beleidigung aufgefasst und waren nach lautem Streit gemeinsam wieder abgezogen. Die beiden Kinder von damals waren heute Nacht meine Retter gewesen. Und das erklärte auch ihre merkwürdige Sprache: Sie hatten, da sie kaum Kontakt zu anderen Menschen gehabt hatten, ihre eigene Art der Kommunikation entwickelt. Ob ihre Eltern noch lebten?
Ich sah mich um. Nichts deutete darauf hin, dass hier weitere Menschen wohnten. Ein paar Lumpen lagen herum, einige primitive Waffen, viele Fackeln. In einer Ecke erkannte ich eine Art Lager: Stroh, Laub und Reisig, schlicht auf den Boden gekippt; sicher nicht bequem, aber besser, als auf dem nackten Steinboden zu schlafen.
Neugier erwachte in mir: Ich war letzten Sommer in dieser Siedlung gewesen und von einem Kind angefallen worden, einem wilden Kind, das ich in meinem Schock zunächst für ein Tier gehalten hatte. Dies hier waren nun definitiv Menschen, freundliche Menschen, aber die Ähnlichkeit zu meinem wilden Kind war nicht zu leugnen. Das Haar war auf gleiche Art verfilzt, die Kleidung zerfetzt und dutzendfach wieder genäht, die Gesichter maskiert unter Schmutz.
»Wie viele seid ihr?«, fragte ich die Frau langsam und deutlich. Wahrscheinlich hatte sie Schwierigkeiten, mich zu verstehen.
Sie zählte ebenso langsam an ihren Fingern ab: eins, zwei, drei.
Wusste ich es doch! »Bei euch ist ein Kind, oder?«
Sie wiegte den Kopf. Es sah aus, als sei sie nicht sicher. Verstand sie mich nicht?
»Star«, sagte die Frau und kniete am Feuer nieder. »Kommt und geht. Kommt und geht. Mal Kind, mal wild. Wie Tier.«
Die Narbe an meiner Hand pochte. Zweifellos sprachen wir vom gleichen Kind. »Star? Ist das sein Name?«
»Star, Starling, wie Vogel. Macht Geräusche nach.«
Ich nickte. Sie hatte recht, der Star war ein Vogel, der Laute imitierte. Matthial hatte vor Jahren einem Star in der Nähe des Coca-Cola-Hauses den Pfiff beigebracht, mit dem er seinen Hund rief. Wir hatten uns darüber amüsiert, wie irritiert Rick jedes Mal in die Bäume gesehen
Weitere Kostenlose Bücher