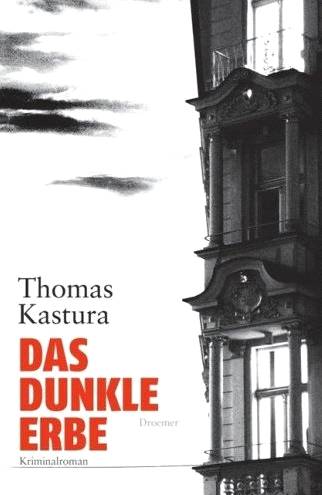![Das dunkle Erbe]()
Das dunkle Erbe
noch einen ellenlangen Vortrag, warum und wieso man bis zum Äußersten Widerstand leisten müsse. Ich glaub, die hatten eine wahnsinnige Angst davor, was ihnen blühte. Und das hat sich dann gegen die eigenen Landsleute entladen.«
Raupach ließ sich auf die Bank nieder. Er betrachtete einen Baumstamm, der über und über Moos angesetzt hatte, man konnte nicht genau sagen, wo die Rinde aufhörte und der Bewuchs begann. Sylvia Feichtner schaute in die entgegengesetzte Richtung.
»Meine Großmutter erzählte alles meinem Vater. Der lag damals in einem Lazarett außerhalb von Köln und erholte sich von einer Granatsplitterverletzung. Großmutter starb kurz darauf an einer Lungenentzündung, die ärztliche Versorgung war ja katastrophal. Und Vater …«, sie atmete durch. »Vater empfand es als Schande, der Sohn eines Verräters zu sein. Er hat es nie verwunden.«
Sie wartete auf eine Reaktion. Der Kommissar schwieg.
»Großvater war kein Soldat, müssen Sie wissen. Er leitete einen kriegswichtigen Betrieb. Von dem blieb am Ende nichts übrig, wegen der Bomben. Außerdem wurden immer mehr Arbeiter an die Front abgezogen. Als er starb, war er quasi bankrott.«
»Damals wurde so manches Lebenswerk zugrunde gerichtet«, stimmte Raupach ihr zu. »Das Ausmaß der Zerstörungen ist für uns heute gar nicht mehr vorstellbar.«
»Ja. Furchtbar.«
»Was wurde aus der Villa in Marienburg?«
»Die blieb intakt, Marienburg wurde nicht so stark zerstört. Zuerst waren die Amerikaner da, und im Juni 1945 wurden sie dann von den Briten abgelöst. Mit Beginn der Besatzungszeit zog sofort ein englischer General ein. Auf dem Haus lag sowieso eine Hypothek, deshalb hat mein Vater von der Militärregierung keinen Pfennig gesehen. Er hat sich seinerzeit mit diesem General Marsh und seinem Adjutanten herumgestritten, um wenigstens unsere Familienandenken zu retten, sonst wäre das alles verlorengegangen.«
»Wie hieß der Mann genau?«
»Graham Marsh. Später fiel die Villa an die Stadt, und die hat sie dann an einen Arzt verkauft.«
Raupach drehte sich zu der Frau um. »Schade. Wäre doch nicht schlecht, heute in Marienburg zu wohnen, in den eigenen vier Wänden.«
Sylvia Feichtner umrundete die Bank und setzte sich neben ihn. »Ein gutes Gefühl hätte ich dabei wahrscheinlich nicht.«
»Warum?«
Sie starrte auf den Boden zwischen ihren Füßen. Jetzt war sie an dem Punkt angelangt, der ihr Schwierigkeiten bereitete, das war nicht zu übersehen. Raupach überlegte, ob er ihr einen kleinen Anstoß geben sollte.
»Was hat Ihr Großvater denn hergestellt in seiner kriegswichtigen Fabrik?«, fragte er.
»Verbandsstoffe. In Kriegszeiten braucht man davon ja jede Menge.«
Raupach nickte. »Immerhin keine Waffen.«
»Davor waren es Tischtücher, Schürzen, Arbeitskleidung«, fuhr sie fort. »Er hat die Produktion Ende der dreißiger Jahre umgestellt. Dadurch konnte er seine Angestellten noch eine Weile halten.«
»Dafür waren sie ihm sicher dankbar.«
»Man musste sich damals anpassen, die Möglichkeiten ausschöpfen – in dem engen Rahmen, den die Regierung vorgab.«
»Die Nazis machten genaue Vorgaben«, sagte Raupach.
Sie wandte sich dem Kommissar zu. In seinen Augen las sie, dass er ahnte, was sie vor ihm zurückhielt. Sie sollte es selber aussprechen, so musste das vonstatten gehen.
»Es war nämlich so, dass die Fabrik eigentlich einem Juden gehört hatte. Großvater war bei ihm Geschäftsführer, ein sehr guter, wenn ich das sagen darf, das weiß ich von ehemaligen Angestellten. Aber die Aufträge gingen zurück, obwohl sich die Wirtschaftslage in den dreißiger Jahren verbesserte. Für jüdische Betriebe wurde es auch immer schwieriger, ausreichend Rohstoffe zu bekommen, Baumwolle zum Beispiel, die Zulieferungen wurden vom Ministerium einfach gekürzt. Oder die Lieferanten froren die Geschäftsverbindung ein, manche beteiligten sich auch ganz offen am Boykott. Ganz zu schweigen von der Propaganda gegen die Juden, die wurde immer aggressiver. Es war klar, dass Herr Springmann, so hieß der Besitzer, über kurz oder lang enteignet werden würde, das zeichnete sich ab. Also musste etwas geschehen. Großvater verstand sich sehr gut mit seinem Chef, da herrschte gegenseitiges Vertrauen. Es ging ja vor allem darum, dass die Firma nominell keinem Juden gehören durfte. Wie das dann in der Praxis aussah, stand auf einem anderen Blatt. Sie machten Folgendes: Großvater kaufte Springmanns Geschäftsanteile, aber nur pro
Weitere Kostenlose Bücher