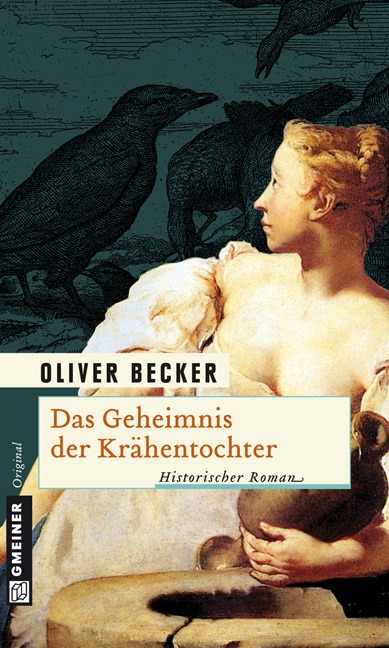![Das Geheimnis der Krähentochter]()
Das Geheimnis der Krähentochter
irgendwohin
verschwunden, ohne Bernina etwas mitzuteilen.
Auch Eusebio war inmitten des sie alle umgebenden Chaos
verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen, und Bernina machte sich große
Sorgen, dass sowohl dem einen als auch dem anderen etwas zugestoßen sein
mochte. Die letzten Stunden waren ihr wie ein ganzes Jahrhundert erschienen,
eine scheinbar endlose Zeit. Zum ersten Mal war ihr das eigene Leben, ja jedes
Menschenleben, so nichtig, bedeutungslos vorgekommen. Bernina war völlig
ausgebrannt, nicht nur körperlich, auch geistig fühlte sie sich am Ende. Alles
tat weh, ihre Hände und Arme, ihre Beine, ihr Kopf, ihre Seele – es war,
als würde jeder einzelne Gedanke Schmerzen in ihr auslösen. Zuerst hatte sie
noch Hunger und vor allem Durst verspürt, auch die Sehnsucht danach, sich etwas
ausruhen zu können, dann war ihr übel geworden; jetzt fühlte sie gar nichts
mehr.
Nicht einmal die ständige Nähe des Todes hatte an ihrer Leere
etwas ändern können. Ebenso wenig das plötzliche Erscheinen Benedikt von Korths
und das damit verbundene baldige Ende der Schlacht – die Rettung war keine
Erlösung gewesen, sie hatte sie einfach nur hingenommen, beinahe mit
Gleichgültigkeit. Und über allem hatte diese eine Nachricht geschwebt, die
mitten in der Schlacht wie ein Lauffeuer von Mund zu Mund weitergegeben wurde.
Eine Todesnachricht, von der Bernina niemals für möglich gehalten hätte, dass
sie ihr derart zusetzen, dass sie ihr den Boden unter den Füßen wegreißen
würde.
In dieser dumpfen Erschöpfung erhob Bernina sich nun und streckte
die Arme weit von sich, ließ sie dann ein wenig kreisen. Einfach nur um
festzustellen, ob überhaupt noch Leben in ihr war. Sie zog sich auf den Bock
des Planwagens hinauf und fragte sich, was das Schlimmste gewesen war, das sie
im Laufe dieses Tages miterlebt, mitangesehen hatte. Schauer rieselten noch
immer an ihrem Körper herab, wenn sich bestimmte Bilder vor ihr geistiges Auge
schoben. Allein das Blut. Unmengen davon, wie die Flüsse und Bäche, die den
Schwarzwald durchzogen.
Und all die verzerrten Gesichter.
Zudem Melchert Poppels Instrumente. Etwa die Knochensäge, mit der
er zerschossene Hände und Füße vom Rest des Körpers getrennt hatte. Dieses
furchtbare Geräusch … Diese Prozedur …
Zuerst wurde der Verletzte von Poppel und Bernina auf einen hastig
aufgestellten Klapptisch gelegt, auf dem das Blut vieler ebenso unglückseliger
Vorgänger eingetrocknet war. Dann war es an Bernina, dem armen Mann Branntwein
aus einem großen Trinksack einzuflößen. Danach schob sie ihm ein Stück Leder
oder Holz zwischen die Zähne und Poppel begann ohne Zögern mit seiner Arbeit.
Bernina musste sich mit ihrem ganzen Körpergewicht, mit ihrer gesamten Kraft auf
Arme und Oberkörper des flach Daliegenden werfen, um ihn so ruhig wie möglich
auf dem Tisch zu halten, was allerdings niemals gelang. Am besten für alle war
es, wenn der Verletzte aufgrund der Schmerzen rasch in eine gnädige Ohnmacht
sank.
Manche allerdings verloren ihr Bewusstsein trotz allem nicht. Sie
bissen mit übermenschlicher Anstrengung auf das Leder oder das Holz, jeder mit
dem gleichen qualvollen Blick. Die schrecklichen Bilder dieses Tages drehten
sich in Berninas Kopf, auch die Stimme Melchert Poppels kreiste in einem fort
durch ihre Gedanken. Nachdem er lange ohne ein einziges Wort, scheinbar für
immer stumm geworden, seine düstere Arbeit verrichtet hatte, war er dazu
übergegangen, unablässig zu reden. Zuerst war Bernina ganz verwundert darüber,
dann wurde ihr klar, weshalb er es tat: um wach zu bleiben, um nicht vor
Erschöpfung zusammenzubrechen.
Sie lauschte dem monotonen Selbstgespräch des Mannes wie dem
beständigen Murmeln eines Baches: ›Was ich auch tue, immer habe ich das Gefühl,
es ist nutzlos. Was ich auch tue – am Ende gehen die armen Teufel doch
zugrunde … Die Menschen werden immer findiger, sich gegenseitig Leid
zuzufügen. Aber es gelingt uns nicht, es zu lindern. So viel müssen wir noch
lernen … Es ist immer das Gleiche, es ist wie ein Tauziehen, du holst die
armen Kerle ins Leben zurück, und der Tod zieht sie wieder ein Stück näher an
den Abgrund. Ein ewiger Ringkampf, Himmel gegen Hölle, ein Kampf um jede
einzelne Seele. Wieso nur denke ich immerzu, dass die Hölle am Ende doch gewinnt …‹
So war es weitergegangen, während Poppel sich über einen
Verletzten nach dem anderen beugte und ihm der Schweiß von der bleichen
Nasenspitze
Weitere Kostenlose Bücher