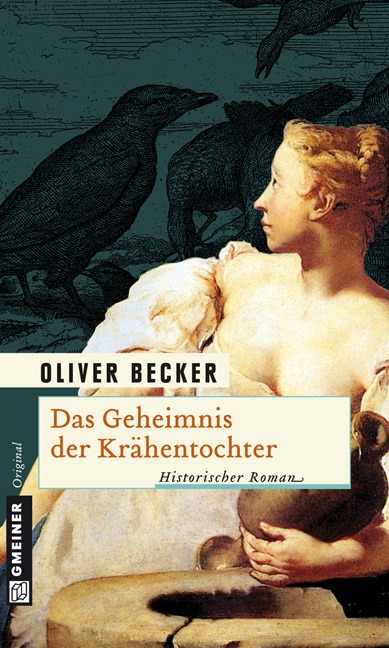![Das Geheimnis der Krähentochter]()
Das Geheimnis der Krähentochter
plötzlich da, wie ein lebendiges Wesen, das sich geschickt
angeschlichen hatte. Ein dunkles, zweistöckiges Steingebäude, gestützt von
aufwändigem Fachwerk, mit spitz zulaufendem, an beiden Seiten weit hinunter
gezogenem Strohdach. Es war vornehmer als jedes andere Haus des Ortes. Aus dem
Schornstein ringelte sich ein Qualmfaden dem blauschwarzen, von zerfetzten
Wolken bedeckten Abendhimmel entgegen. Die Tür öffnete sich, als sie noch
einige Meter davon entfernt waren, und ein weiterer Soldat trat ins Freie. Er
war eleganter gekleidet als die beiden anderen und hielt keine Muskete in der
Hand. In seinen Augen blitzte Erleichterung auf, als er Poppels Arzttasche sah.
»Der Knochenschneider«, rief er. »Endlich.« Dann maß sein Blick
Berninas Gestalt.
»Das ist meine Gehilfin«, erklärte Poppel, bevor eine Frage
gestellt werden konnte.
Mit einem ungeduldigen Kopfnicken wies der Mann ins Haus. »Nichts
wie rein mit Ihnen und Ihrer Gehilfin. Hatten Sie nicht den Befehl, sich so
schnell wie möglich nach Kraubach zu begeben?«
»Das habe ich auch getan«, verteidigte sich Poppel.
Der Mann erwiderte nichts, sondern ging voran ins Haus. Poppel und
Bernina folgten, während die anderen beiden Soldaten draußen verharrten.
Dunkel war es, nach Holz roch es, nach gebratenem Fleisch, das vor
Kurzem in einem der Räume verspeist worden sein musste. Schweres Gebälk stützte
die tiefe Decke. Nach den Anstrengungen der letzten Tage war es für Bernina
trotz ihrer Anspannung nicht unangenehm, in die Wärme eines Hauses schlüpfen zu
können.
An Poppels Schulter vorbei spähte sie in einen finsteren Gang, an
dessen Ende eine geöffnete Zimmertür zu erkennen war. Doch dieser Raum war
nicht das Ziel. Der Soldat führte sie beide eine schmale Treppe hinauf ins
obere Stockwerk. Auch hier der gleiche Geruch, die gleiche spröde Dunkelheit,
ein ähnlicher Gang, wiederum mit einer offen stehenden Tür. Aus dem Raum
dahinter schimmerte Licht, ein Schemen aus Helligkeit, dessen Flackern
offensichtlich von mehreren Kerzen stammte.
Der Soldat stellte sich auf die Schwelle. »Der Arzt ist da.«
»Rein mit ihm«, antwortete eine männliche Stimme.
Sofort machte der Soldat einen Schritt zur
Seite, um Poppel und Bernina vorbeizulassen. Hinter dem Feldarzt betrat Bernina
das Zimmer. Auch hier die tiefe Decke, die klobigen Stützpfeiler, die warme,
abgestandene Luft, der Geruch brennender Kerzen. Das einzige Fenster war von
einer fleckigen, an den Rändern eingerissenen Flagge verdeckt: Auf hellblauem
Grund prangte der schwarze Falke. Eine knisternde Stille schwebte durch den
Raum, der größer war, als Bernina es zunächst angenommen hatte.
Fünf Männer standen beisammen, jeder mit großem Hut und Degen. Auf
den ersten Blick waren sie unzweifelhaft als Offiziere zu erkennen. Sie wandten
sich den beiden Eintretenden zu. In ihrer Mitte öffnete sich eine Schneise für
den Arzt, sodass die Sicht frei wurde auf ein Bett, dessen Kopfende an die
hintere Wand geschoben worden war. Neben dem Bett ein winziger Tisch, auf dem
sich Tücher, Blechtassen, Zinnbecher und ein Kerzenhalter mit fast
heruntergebrannter Kerze befanden. Poppel trat an das Bett heran, während
Bernina wie angewurzelt stehen blieb.
Ihr Blick glitt an der Gestalt des Arztes vorbei, hin zum Bett, zu
dem Mann, der darauf lag, auf dem Rücken, das Kissen unter dem Kopf, die Arme
ihrer Länge nach an den Seiten, sodass die Hände unter der nach unten gezogenen
Decke verschwanden.
Bernina sah auf den Verband, der den Bauch umhüllte, von roten
Flecken durchsetzt. Weiß die Haut des Oberkörpers und der Arme, unter der
bläuliche Adern schimmerten. Sie blickte auf das ebenso weiße Gesicht: Wangen
ohne Leben, geschlossen die farblosen Lippen, geschlossen auch die Augen.
In Bernina war alles eiskalt – so kalt wie in jenem Moment am
Rande des Schlachtfeldes, als sie vom Tod dieses Mannes erfahren hatte, dessen
Leiche hier lag, so eigenartig unwirklich. Bernina verstand nicht, was das
alles sollte. Warum hatte man den Toten hierhergebracht? Was sollte Melchert
Poppel tun?
Alles, was sie wusste, war nur, dass es irgendetwas gab, das sie
mit Jakob von Falkenberg verband. Und dass sie nun niemals dahinterkommen
würde, was das sein konnte. Sie spürte dieses Band, spürte es so unmittelbar
wie vor Kurzem Falkenbergs Hände auf ihren Armen, seinen Mund auf ihrem Mund.
Und dann geschah etwas, das die Kälte in ihr noch eisiger werden
ließ. Wie unter dem Einfluss
Weitere Kostenlose Bücher