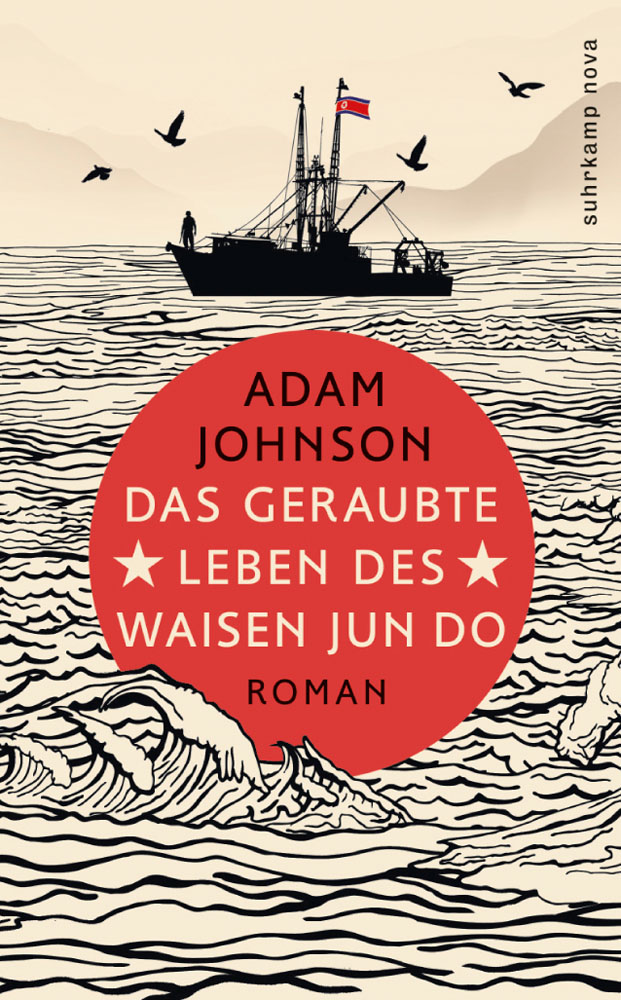![Das geraubte Leben des Waisen Jun Do]()
Das geraubte Leben des Waisen Jun Do
»Meine Geschichte hat schon zehn Mal geendet und hört doch nie auf. Ständig ist mir das Ende auf den Fersen, reißt aber nur alle anderen mit. Waisenkinder, Freunde, Vorgesetzte – ich überlebe sie alle.«
Ganz offensichtlich verwechselte er sich und seine Geschichte, was angesichts der von ihm erlittenen Drangsal nur allzu verständlich war. »Aber das ist doch jetzt nicht Ihr Ende. Es ist ein Neuanfang«, versicherte ich ihm. »Und es stimmt nicht, dass Sie alle Ihre Freunde überlebt haben. Wir beide sind doch Freunde, oder nicht?«
Er starrte an die Decke, als ziehe dort eine Parade der Menschen vorbei, die er einmal gekannt hatte.
»Ich weiß, warum ich auf dem blauen Stuhl sitze«, sagte er. »Wie steht es mit Ihnen?«
Die vielen rot-weißen Kabel auf seinem Kopf zu ordnen war, als flechte man jemandem die Haare.
Ich erzählte: »Früher wurde in dieser Abteilung wichtige Arbeit geleistet. Hier wurden Bürger und ihre Geschichte voneinander getrennt. Das war meine Aufgabe. Die Geschichte bewahrten wir auf, und den dazugehörigen Menschen beseitigten wir. Das fand ich richtig so. Viele Rechtsabweichler und Konterrevolutionäre wurden so enttarnt. Zugegeben, manchmal mussten die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen dran glauben, aber anders ließ sich die Wahrheit nicht herausfinden. Und leider war es auch so, dass man einem Menschen seine Geschichte nicht wieder zurückgeben konnte, wenn man sie ihm erst einmal entrissen hatte – mit Stumpf und Stiel sozusagen. Aber jetzt ...«
Ga verdrehte den Kopf und sah mir ins Gesicht. »Ja?«
»Jetzt verlieren wir den Klienten zusammen mit seiner Geschichte. Beide sterben.«
Ich stellte an seinem Autopiloten die Ausgangsleistung ein. Ga hatte einen starken Willen, also stellte ich sie auf acht.
»Würden Sie mir noch einmal erklären, wie Vertrauen funktioniert?«, bat ich ihn.
»Eigentlich war es gar nicht schwer«, antwortete Ga. »Man sagt dem anderen alles, das Gute wie das Schlechte – das, was einen stark aussehen lässt, und auch das, was beschämend ist. Wenn man den Mann seiner Frau umgebracht hat, dann muss man ihr das gestehen. Wenn ein Mann versucht hat, einen zu attackieren, dann muss man auch das sagen. Ich habe Ihnen alles gesagt, so gut ich es konnte. Ich weiß vielleicht nicht, wer ich bin. Aber die Schauspielerin ist frei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was Freiheit ist, aber ich habe sie gespürt, und das tut sie jetzt auch.«
Ich nickte. Es war beruhigend, das noch einmal zu hören. Mein innerer Frieden war wiederhergestellt. Endlich war ich meinen Eltern ganz nah gekommen und hatte ihnen völlig vertraut. Und Kommandant Ga war mein Freund, auch wenn er mich anlog und behauptete, die Schauspielerin sei noch am Leben. Das hatte er so vollständig verinnerlicht, dass es für ihn wahr zu sein schien. In seiner verqueren Logik sagte er mir, seinem Freund, die reine Wahrheit.
»Wir sehen uns auf der anderen Seite«, sagte ich.
Sein Blick war auf einen Punkt gerichtet, den es nicht gab.
»Meine Mutter war Sängerin«, sagte er.
Als er die Augen schloss, legte ich den Schalter um.
Er machte die üblichen unwillkürlichen Bewegungen, riss die Augen auf, ließ die Arme flattern und schnappte nach Luft wie ein Karpfen an der Oberfläche eines Fischteichs. Meine M utter war Sängerin waren seine letzten Worte, so, als sagte nur das etwas darüber aus, wer er gewesen war.
Ich stieg auf den blauen Stuhl neben ihm, legte allerdings keine Lederriemen an. Die Pubjok sollten wissen, dass ich meinen Weg selbst gewählt hatte, dass ich ihre Methoden ablehnte. Ich befestigte die Elektrodenhaube auf meinem Kopf und stellte die Ausgangsleistung ein. Nie wieder wollte ich mich an irgendetwas erinnern, was mit Abteilung 42 zu tun hatte, also stellte ich sie auf achteinhalb. Andererseits wollte ich nicht, dass mir das Hirn wegschmorte. Also korrigierte ich auf siebeneinhalb. Und wenn ich mir selbst gegenüber ganz offen war, dann durfte ich auch zugeben, dass ich Angst vor den Schmerzen hatte. Also entschied ich mich für sechseinhalb.
Zitternd vor Hoffnung und seltsamerweise auch Bedauern legte mein Finger den Schalter um.
Meine Arme erhoben sich vor mir. Sie kamen mir vor wie die eines Fremden. Ich hörte Stöhnen und merkte, dass es von mir kam. Elektrizität züngelte tief durch mein Gehirn, tastend, so, wie eine Zunge zwischen den Zähnen nach Essensresten sucht. Ich hatte mir vorgestellt, dass es eine betäubende Erfahrung sein
Weitere Kostenlose Bücher