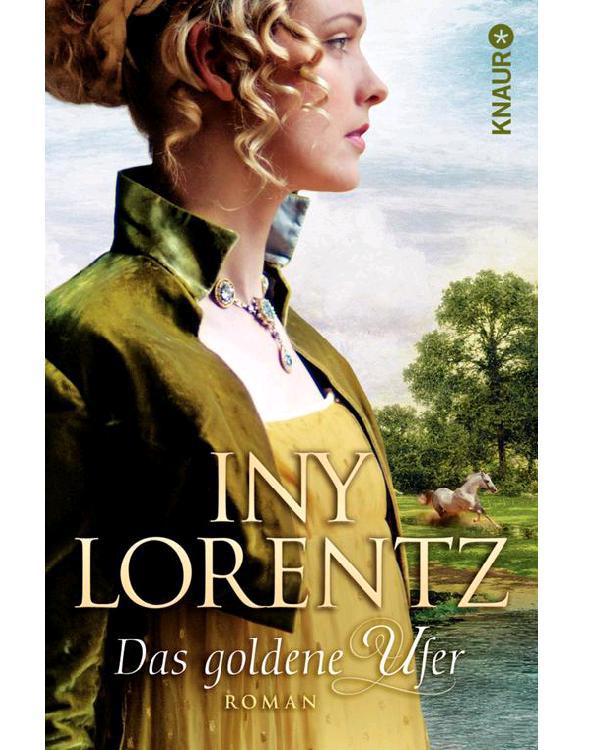![Das goldene Ufer]()
Das goldene Ufer
die Welt so, wie sie war, mit all den Privilegien ihres Standes und der Möglichkeit, weitaus höher aufzusteigen als jeder Bürgerliche, mochte dieser auch noch so fähig sein. Ihr Studium bestritten sie eher nebenbei, denn sie zogen Ausflüge in die Gaststätten der Umgebung und Trinkgelage dem Hörsaal vor. Wenn Wein und Bier ihre Gehirne erhitzten, war ein Reisender, der ihnen auf dem Heimweg entgegenkam, nicht sicher vor ihrem Spott und wurde manchmal auch derb verprügelt.
Da Diebold sich nur selten in den Vorlesungen blicken ließ, schrieb Walther ihm den Lehrstoff auf und erklärte ihm das meiste. Dabei hätte er seine freie Zeit sehr viel lieber mit Landolf Freihart und Stephan Thode verbracht. Auch wenn Thode gelegentlich verletzende Bemerkungen machte, zählten beide zu seinen liebsten Gesprächspartnern. Andererseits sorgte die intensive Beschäftigung mit den einzelnen Themen des Studiums dafür, dass Walther schon bald zu den Besten seines Studiengangs zählte. Thodes Spott, ein Streber zu sein, begleitete ihn daher ständig.
In der aufregenden Welt der Universität verschwand die Zeit auf Renitz beinahe ganz aus Walthers Gedanken. Nur gelegentlich kam ihm der alte Graf in den Sinn und hie und da auch Gisela. Er hatte zwar versprochen, ihr zu schreiben, kam aber nicht dazu. So vergingen Wochen und Monate, und während Walther in eine für ihn neue und aufregende Welt eingetaucht war, ging das Leben auf Renitz ebenso weiter wie seit vielen Generationen.
Das kühle Herbstwetter hatte die Lunge des Grafen angegriffen. Nun lag er in seinem Schlafzimmer und war alles andere als ein bequemer Patient. Der Arzt hatte ihm Tropfen mit einem klangvollen lateinischen Namen verschrieben, die allerdings so penetrant rochen, dass Medard von Renitz sich weigerte, sie einzunehmen. Stattdessen vertraute er auf die Aufgüsse von Kamille, Allerweltsheil, Teufelsmilchkraut und anderer Kräuter, die Cäcilie ihm zubereitete.
Seine Gemahlin machte ihm deswegen Vorwürfe. »Ihr solltet Euch weniger dem Aberglauben der Köchin als vielmehr der studierten Kunst unseres Doktors anvertrauen!«
Renitz versuchte, sich aufzurichten, erlitt aber einen Hustenkrampf und hielt sich rasch ein Tuch vor den Mund, um den Auswurf darin aufzufangen. Danach erst war er in der Lage, seiner Gemahlin zu antworten.
»Cäcilies Aberglaube, wie Ihr es nennt, verschafft mir Linderung, während das sogenannte Heilmittel des Arztes meinen Magen und meine Gedärme verbrennt. Ich kann es nicht nehmen.«
»Ihr müsst!«, beharrte seine Frau und träufelte die vorgeschriebenen zwanzig Tropfen auf einen Löffel. Anschließend befahl sie ihrem Gemahl, den Mund zu öffnen.
»Ich will es nicht!«, rief dieser und schlug nach dem Löffel, so dass dessen Inhalt auf Gräfin Elfredas Kleid spritzte.
»Ihr seid einfach unmöglich!«, schrie sie ihn an und hob den Löffel, als wolle sie ihn ihrem Mann an den Kopf werfen. Sie beherrschte sich aber und rauschte wie das leibhaftige Sinnbild einer sich gekränkt fühlenden Ehefrau aus dem Zimmer.
Draußen traf sie auf Gisela. Bisher hatte die Gräfin, was das Mädchen betraf, auf den Willen ihres Ehemanns Rücksicht nehmen müssen. Aber da dieser nun krank im Bett lag und sie nicht wusste, ob er sich je wieder erholen würde, war sie nicht mehr dazu bereit.
»Bleib stehen!«, rief sie.
Gisela verharrte und knickste vor der Gräfin. Ängstlich fragte sie sich, was die Herrin von ihr wollte, denn in all den Jahren hatte Elfreda von Renitz so getan, als existiere sie nicht.
Die Gräfin sah mit einem gewissen Neid auf das blühende junge Ding herab, das ihr die Vergänglichkeit der eigenen Schönheit so deutlich vor Augen führte, und ihre Stimme bekam einen giftigen Tonfall. »Dieser Unsinn, dich zu Weihnachten in die Stadt zu schicken, hat ein Ende! Es gibt um die Zeit zu viel Arbeit im Schloss, als dass ich auf dich verzichten könnte. Hast du verstanden?«
Für Gisela war diese Entscheidung ein Schlag ins Gesicht. Sechsmal hatte sie das Christfest bei Menschen ihres eigenen Glaubens verbracht und dabei Schwester Magdalena lieben gelernt wie eine Mutter.
Das könnt Ihr nicht tun, hätte sie am liebsten gerufen, denn der Herr Graf hat es mir erlaubt. Doch angesichts des boshaften Blicks ihrer Herrin, die nur auf ein falsches Wort zu lauern schien, blieb sie stumm.
»Du kannst wieder an deine Arbeit gehen«, forderte Gräfin Elfreda sie auf.
Gisela war froh, ihr entkommen zu können. Mit tränenden Augen
Weitere Kostenlose Bücher