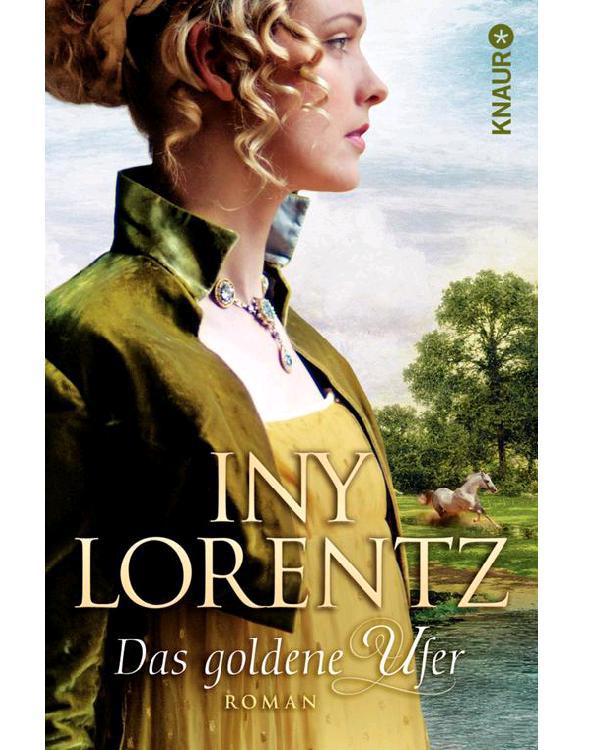![Das goldene Ufer]()
Das goldene Ufer
lief sie in den Teil des Schlosses, in dem ihr winziges Kämmerchen lag, und schloss die Tür hinter sich zu. Der Verstand sagte ihr, dass sie damit hatte rechnen müssen. Der Gräfin war seit jeher ein Dorn im Auge, dass sie Weihnachten bei den Nonnen verbringen durfte, und wenn es der Frau nach gegangen wäre, hätte man sie zwangsweise dem protestantischen Glauben zugeführt. Auch Pastor Künnen hatte sich immer wieder bemüht, ihr den katholischen Aberglauben – wie er es nannte – auszutreiben, und sie hatte es nur dem Einschreiten des Grafen zu verdanken, dass der Pastor mittlerweile davon Abstand genommen hatte.
Gisela schmerzte die Entscheidung der Gräfin zutiefst. Wenigstens noch dieses eine Mal, sagte sie sich, hätte sie ins Kloster fahren wollen. Nein, müssen!, korrigierte sie sich und wischte die Tränen mit den Ärmeln ab. Schluchzend öffnete sie eine Schublade der alten Kommode, die man ihr zugebilligt hatte, griff tief unter ihre Hemden und zog ein silbernes Kruzifix hervor. Schwester Magdalena hatte es ihr beim letzten Weihnachtsfest geschenkt. Nun hatte Gisela in ihren wenigen freien Stunden ein Deckchen mit frommen Motiven bestickt, um es der Nonne beim nächsten Fest zu überreichen. Das war ihr nun nicht mehr möglich.
Bei dem Gedanken straffte Gisela den Rücken. Auch wenn sie Gräfin Elfredas Willkür ausgeliefert war, so würde es ihr trotzdem gelingen, Schwester Magdalena diesen Beweis ihrer Dankbarkeit zukommen zu lassen. Mit dem wenigen Geld, das sie gespart hatte, konnte sie das Deckchen gut verpackt dem Postmeister des Nachbardorfs anvertrauen, damit dieser es nach Hildesheim weiterleitete. Vielleicht konnte sie auf diese Weise sogar Briefe mit Schwester Magdalena wechseln. Über Renitz war dies nicht möglich, da alle Briefe durch die Hände der Gräfin gingen, und dieser traute sie zu, Schwester Magdalenas Briefe aus reiner Bosheit zu unterschlagen.
Von trotzigem Mut erfüllt, wusch sie sich das Gesicht mit dem Wasser, das sie in einem angeschlagenen Krug bereithielt, trocknete sich ab und ging dann mit einer so gleichmütigen Miene an ihre Arbeit, als wäre nichts gesehen.
8.
D ie Stimmung unter den Studenten war schlecht. Immer wieder gab es Strafen und Verweise wegen aufrührerischer Reden oder weil verbotene Abzeichen oder Symbole bei einigen gefunden wurden. Walther war empört über die Willkür und Ungerechtigkeit, die die Professoren der Universität und die Behörden übten, indem sie Freunde der Überführten oder zufällig in der Nähe weilende Studenten gleich mit bestraften. Dennoch hielt er sich anders als seine Freunde Stephan Thode und Landolf Freihart zurück, um nicht selbst in die Mühlen der Behörden zu geraten und dadurch der Möglichkeit beraubt zu werden, sein Studium abschließen zu können. Ein Vater mochte seinen Sohn auf eine andere Universität schicken. Graf Renitz aber würde dies bei ihm mit Sicherheit nicht tun.
Diese Abhängigkeit von der Gunst eines einzigen Menschen machte Walther immer mehr zu schaffen. Was würde sein, wenn sein Gönner starb? Von Gräfin Elfreda hatte er nichts Gutes zu erwarten, und Diebold sah ihn als seinen persönlichen Lakaien an, der ihm bedingungslos zu gehorchen hatte. Während der junge Renitz sein Studentenleben in vollen Zügen genoss, musste er für ihn das Gelernte in knappen Worten niederschreiben und dabei auch gleich Antworten auf Fragen vorformulieren, so dass Diebold den Anschein eines mäßig guten Studenten aufrechterhalten konnte, obwohl er sich kaum in den Hörsälen blicken ließ.
Trotz dieser Belastung kehrte Walther einmal in der Woche nach der letzten Vorlesung nicht sofort in das Haus der Witwe Haun zurück, sondern ging zusammen mit Landolf Freihart und Stephan Thode in eine kleine Gastwirtschaft. Dort setzten sie sich an einen Tisch, der nicht für Stammgäste freigehalten wurde, und bestellten je einen Krug Bier.
An diesem Tag starrte Stephan, der schon mehrfach eine Strafe wegen Aufsässigkeit erhalten hatte, besonders düster auf die altersdunkle Eichenplatte. »Ich kann gar nicht so viel essen und trinken, wie ich erbrechen möchte!«, stieß er leise hervor.
»Was ist denn los?«, wollte Walther wissen.
»Der Sohn unseres Nachbarn daheim ist ein halbes Semester vor seinem Studienabschluss wegen angeblich aufrührerischer Reden der Universität verwiesen worden. Nun will sein alter Herr ihn nicht auf eine andere Universität schicken. Der Ärmste ist vollkommen verzweifelt, denn er
Weitere Kostenlose Bücher