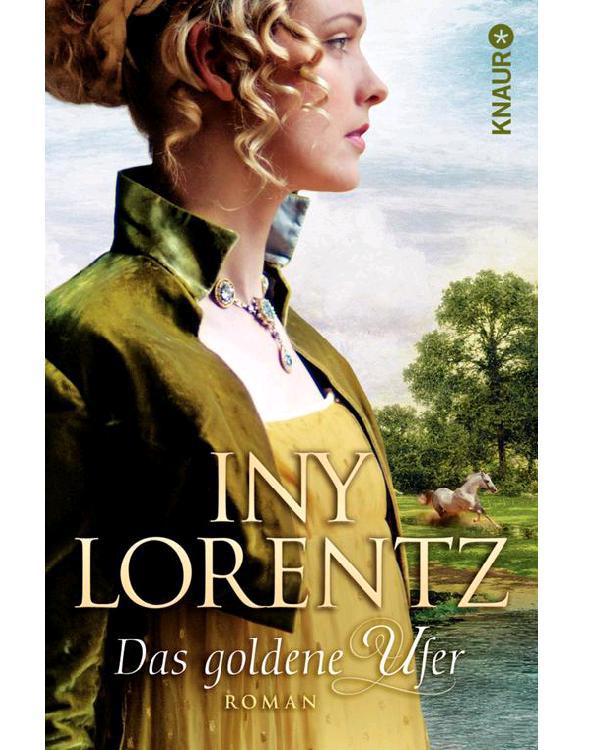![Das goldene Ufer]()
Das goldene Ufer
ihm bereits mehrere Jahrgänge voraus waren.
Unwillkürlich sah er zu Diebolds Freunden hin, die eng zusammenstanden. Diese wirkten eher trotzig als schuldbewusst. Freiwillig würde sich keiner von ihnen melden. Allerdings würde auch keiner von ihnen einen ihrer Standesgenossen verraten.
Artschwager schien dies ebenso zu sehen, denn er stieß nun heftige Drohungen aus bis hin zu dieser, dass der Universitätsbetrieb nicht weitergeführt werde, bis der Schuldige entlarvt sei. Damit erregte er den Unmut der Studenten, die nun lautstark dagegen protestierten.
»Das ist ungerecht, Herr Professor!«, rief Stephan Thode. »Es ist nicht einmal bewiesen, dass es einer von uns gewesen ist. Es gibt genügend Zecher, die des Nachts nach Hause gehen und die Möglichkeit haben, das königliche Haupt mit einer Narrenkappe zu krönen!«
»Jawohl, so ist es!«, stimmten ihm mehrere ältere Studenten zu.
Der Professor wollte auf den Vorwurf antworten, wurde aber von den empörten Studenten überschrien. Schließlich marschierten die Gendarmen auf und bildeten eine Linie vor den sich bedroht fühlenden Professoren.
Als die jungen Männer auf die gefällten Bajonette starrten, wurden sie leiser. Ein unterschwelliges Gemurmel hielt jedoch an, und Walther ahnte, dass die Situation jederzeit eskalieren konnte, wenn auch nur einer der Beteiligten die Nerven verlor.
Das erkannten auch die Herren von der Universität, denn sie berieten sich mit besorgten Mienen. Anschließend forderte Artschwager alle Studenten auf, in ihre Quartiere zurückzukehren.
»Sollte der Schuldige sich bis heute Abend bekennen oder genannt werden, werden die Vorlesungen morgen wie gewohnt weitergehen«, setzte er hinzu und wollte noch mehr sagen, wurde aber durch einen wütenden Zwischenruf unterbrochen.
»Wir sind keine Denunzianten, Herr Professor! Selbst wenn ich wüsste, wer es war, würde ich es nicht sagen, da Tat und Strafe in keinem Verhältnis zueinander stehen.«
»Genauso ist es!«, hörte Walther seinen Freund Stephan Thode rufen.
Artschwager bewahrte die Ruhe. »Laut Recht und Gesetz, dem wir alle zu gehorchen haben, ist die Beleidigung des Staatsoberhaupts ein strafwürdiges Verbrechen. Meine Herren, wenn Sie einmal aufrechte Bürger unseres Königreichs Hannover, des Königreichs Preußen oder Ihrer anderen Heimatländer werden wollen, müssen Sie begreifen, dass ein Verstoß gegen Gesetze nur zu Unordnung und Chaos führt. Und nun verlassen Sie den Platz. Wir müssten sonst Militär anfordern, um ihn zu räumen.«
Nun trollten sich die ersten Studenten, doch ihr Zorn war noch lange nicht verraucht. Etliche ballten die Fäuste und schimpften auf die Professoren und die Behörden, ganz besonders aber auf Professor Artschwager.
»Der redet von aufrechten Bürgern und buckelt vor den hohen Herrschaften, dass es zum Erbrechen ist«, ereiferte Stephan Thode sich.
»Ich finde es ungerecht, uns alle auszusperren, nur weil ein Unbekannter sich einen Scherz erlaubt hat!« Walther schüttelte verständnislos den Kopf. Dabei trieb ihn insgeheim weiter die Sorge um, dass Diebold hinter dem Ganzen stecken mochte. Immerhin war dieser aus Richtung des Denkmals gekommen und stark betrunken gewesen. So oder so konnte er den Sohn seines Wohltäters schlecht denunzieren. Zumal Elfreda von Renitz es ohnehin ihm anlasten würde, falls man Diebold von der Universität verwies. Damit verlöre er auch Graf Renitz’ Unterstützung und müsste ebenfalls die Georg-August-Universität verlassen.
Während Walther seinen Gedanken nachhing, waren die meisten anderen Studenten verschwunden, und er, Stephan und Landolf sahen sich mehreren Gendarmen gegenüber, die mit angeschlagenen Gewehren auf sie zukamen.
Stephan stieß seine beiden Freunde an. »Los, weg von hier!«
Sie rannten los, während hinter ihnen das höhnische Gelächter der Gendarmen aufklang, die es ihrer Ansicht nach diesem Studentengesindel wieder einmal gezeigt hatten.
Erst einige Straßen weiter blieb Stephan stehen. »Welche Ungerechtigkeit! Wenn ich könnte, würde ich gleich heute nach Amerika reisen.«
»Wie viel Geld braucht man dazu?«, fragte Walther. Öfter schon hatte er erwogen, in einigen Jahren Graf Renitz’ Dienste zu verlassen, aber nie ernsthaft an eine Auswanderung auf einen anderen Kontinent gedacht. Nun wollte er zumindest wissen, was es damit auf sich hatte.
»Du brauchst nicht nur Geld, sondern vor allem auch einen Pass, damit man dich in Bremen oder Hamburg auf ein Schiff
Weitere Kostenlose Bücher