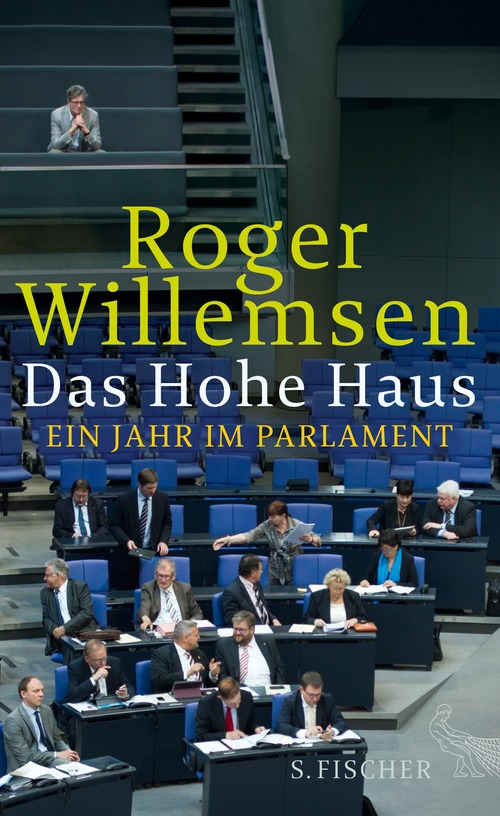![Das Hohe Haus]()
Das Hohe Haus
eine Idee, eines schaukelt in der eigenen Schläfrigkeit, eines hat sich tief in die Verpuppung zurückgezogen. Da unten kommen Menschen herein, stellen ihre Rede in die Schlange aller Reden und gehen. Nicht jeder sagt mit demselben Recht »ich«. Nicht hinter jedem »Ich« sammelt sich die ganze Person. Manchmal steht jemand hinter dem Pult, der nur zaghaft sein Ich sagt und es gleich wieder ausradieren möchte, und manchmal bezieht dieses Ich seine Wucht aus einem weit entfernten Wahlkreis, wenn der Redner sagt: »Ich bin nicht überzeugt.«
Als ich meinem Hunger endlich nachgebe und den Saal verlasse, ist das Parlament fast leer. Die Verwaltung der Langeweile setzt ein. Sie ist ein Berufsmerkmal des Parlamentariers. Manchmal gehe ich inzwischen ja selbst in dieses Haus wie in eines dieser alten Nonstop-Kinos, in denen immer etwas los war. Wenn man den Saal betritt, befindet man sich nie im Zusammenhang, aber manchmal sind Vorgeschichte und Fortsetzung auch egal. Jemand steht am Pult und nimmt doppelt Recht für sich in Anspruch: das Recht zu reden und das Recht in der Sache. Die Spuren der verflossenen Scharmützel sind verwischt, die Wirkungen der Anwürfe haben sich verflüchtigt. Kaum zu glauben, dass sich hier heute Morgen noch die Erregungen ballten, dass »über Deutschland« entschieden wurde, dass es ein guter oder ein weniger guter Tag für dieses Land sein konnte. Ich erinnere mich an diese Frauen gegen die Frauenquote – Merkel, Aigner, Schröder, von der Leyen –, die manchmal wie Komplizinnen wirkten, wie eine Gang – die sich gegen was verschworen hatte? Die eigene Sache.
Sie sind eben schon wieder »auf einem guten Weg«. Die politische Rhetorik schließt diesen »Weg« notorisch ein. Das entlastet; kein Ziel, kein Ankommen muss es geben, doch immerhin sind wir aufgebrochen. Das ist zwar eine Binsenwahrheit, aber Teil der parlamentarischen Sprachordnung: Dass wir »vor Herausforderungen stehen«, heißt ja auch bloß, dass wir bisher zu wenig getan haben. Es ist eine Redeform, die sich so herausbilden konnte, weil sie um Zuhörerschaft nicht mehr ringen muss. Die Bedeutung wird unterstellt, der Ort der Rede verleiht sie. Man kann die Würde des Hauses also nicht auf die Sprache übertragen. Denn diese muss, Friedrich Hölderlin zufolge, nicht vor allem gesprochen, sondern bewohnt werden. Wird sie es nicht, klingt sie wie aus dem rhetorischen »man« gesprochen.
Das Recht der öffentlichen Rede ist ein kostbares Privileg, man darf es also nicht missbrauchen. Die beste Form, von ihm Gebrauch zu machen, ist es, für jene zu reden, die selbst nicht dürfen oder können. Aber wie lange kann man sie aufrichtig vertreten? Andererseits haben viele im Saal zahlreiche Enttäuschungen hinter sich. Selbst die erfahrenen Redner existieren neben ihrer Rede, flanieren durch Sätze, die sie nicht meinen. Nur die Jungen, in ihre Sache Verbissenen oder besonders Ehrgeizigen müssen erst düpiert werden, um in das Metier des Parlamentariers zu passen.
Man hört also zu. Phasenweise ist man der Meinung dessen, der gerade redet. Er ist ja auch selbst seiner Meinung und begleitet sie mit Ausdruck. Überhaupt sind Menschen privat nicht so leicht erregbar wie der Politiker an seinem Pult. Manchmal erinnert dies an Schauspielschulen für Opernsänger. Mit beiden Händen ans Herz zu greifen heißt: Ich bin bewegt, mit der Faust auf den Tisch schlagen: Ich bin zornig, die Arme ausbreiten: Ich meine euch alle. Es ist ein Reden in Schaubildern.
Draußen vor dem Gebäude empfängt mich die Wirklichkeit mit allem, was drinnen verhandelt wird: die Bürger, betriebsam inmitten dieses vielsprachigen Gewirrs der Vergnügungssüchtigen, die Radler, die fahrend flanieren, die Spaziergänger, die duftend eine Straßenbar suchen, die auf dem Trottoir vor dem »Einstein« sitzen mit schimmernden Gläsern, während sich die Abgeordneten mit dem Contergan-Entschädigungsgesetz, der Piraterie vor Somalia, der Straßenreparatur, der Telefonwerbung befassen.
Als ich zurückkehre, sitzen auf der Seite der Linken noch vier Abgeordnete. Sie klatschen tapfer, drängen sich mit Applaus in die Sprechpausen. Andrea Nahles klatscht manchmal amüsiert mit, um ein wenig Flankenschutz für die offenbar richtige Sache zu geben. Man verständigt sich über den Gang hinweg. Jutta Krellmann ( DIE LINKE ) fleht: »Wollen Sie mir bitte mal zuhören?!« Matthias Zimmer ( CDU / CSU ) sagt: »Sozialismus muss man sich leisten können. Wir können
Weitere Kostenlose Bücher