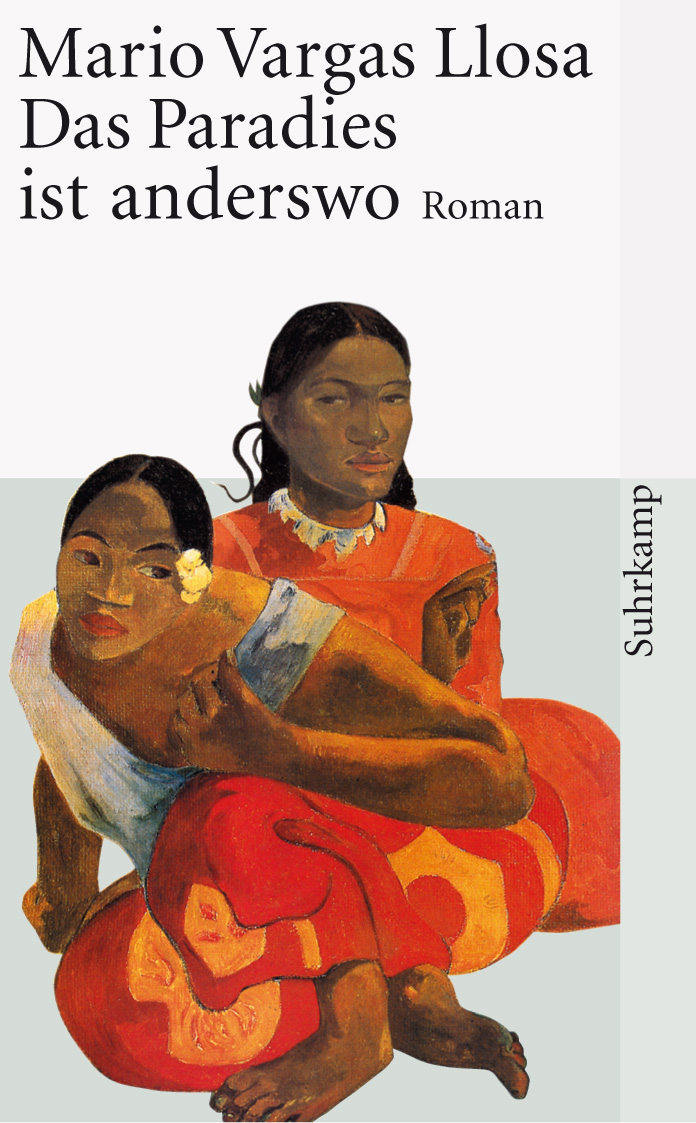![Das Paradies ist anderswo]()
Das Paradies ist anderswo
der Postbeamten, Foncheval oder Fonteval – du irrtest dich immer –, grüßte ihn mit einem Neigen des Kopfes. In aller Ruhe, ohne mit jemandem zu sprechen, ließ er sich das Bier schmecken, in das er seine letzten Centimes investiert hatte, und wartete, daß die beiden Angestellten unter den Flamboyant-Bäumen und Akazien der Rue de Rivoli seinen Blicken entschwanden. Er vertrieb sich die Zeit damit, zu schätzen, wie lange sie brauchen würden, um die auf dem Boden des kleinen Büros verstreuten Pakete und Briefe in Kisten und Säcke zu ordnen. Der Knöchel tat ihm nicht weh. Er spürte nicht das Brennen an den Waden, das ihn die ganze Nacht wach gehalten und seinen Körper mit kaltem Schweiß bedeckt hatte. Dieses Mal würdest du mehr Glück haben als mit dem letzten Schiff vor einem Monat, Koke.
Er zuckelte gemächlich zum Postamt, ohne das Pony anzutreiben, das den kleinen Wagen zog. Auf dem Kopf spürte er die Zunge einer Sonne, die in den folgenden Minuten und Stunden immer glühender werden würde, um dann zwischen zwei und drei Uhr den unerträglichen Höhepunkt zu erreichen. Die Rue de Rivoli lag halbverlassen da, doch es waren Leute in den Gärten und auf den Balkonen der großen Holzhäuser zu sehen. Zwischen dem Gründer hohen Mangobäume erblickte er den Turm der Kathedrale in der Ferne. Die Post war geöffnet. Du warst der erste Kunde dieses Morgens, Koke. Die beiden Postbeamten waren damit beschäftigt, Briefe und Pakete zu ordnen, die bereits in alphabetischer Folge auf dem Auslegetisch aufgereiht waren.
»Für Sie ist nichts dabei«, begrüßte ihn Foncheval oder Fonteval mit betrübtem Gesicht. »Tut mir leid.«
»Nichts?« Er spürte das scharfe Brennen an den Waden, den stechenden Schmerz im Knöchel. »Sind Sie sicher?«
»Tut mir leid«, wiederholte der alte Postbeamte schulterzuckend.
Er wußte sofort, was er tun mußte. Ohne Eile kehrte er nach Punaauia zurück, im Tempo des Pferdes, das seinen kleinen, halbbezahlten Wagen zog, während er die Pariser Galeristen verfluchte, von denen er mindestens seit einem halben Jahr nichts gehört hatte. Das nächste Schiff, das die Route über Sydney befuhr, würde erst in einem Monat eintreffen. Wovon würdest du bis dahin leben, Koke? Der Chinese Teng, Besitzer des einzigen Kaufladens in Punaauia, hatte ihm den Kredit gesperrt, weil er die für Konserven, Tabak und Alkohol aufgelaufenen Schulden seit zwei Monaten nicht bezahlt hatte. Aber das war nicht das Schlimmste, Koke. Du warst daran gewöhnt, bei der halben Welt verschuldet zu sein, ohne deshalb dein Selbstvertrauen oder die Liebe zum Leben zu verlieren. Doch ein Gefühl von Leere, von Verbrauchtheit hatte sich vor drei oder vier Tagen deiner bemächtigt, als dir klar wurde, daß das riesige, vier Meter breite und fast zwei Meter hohe Bild, das größte, das du je gemalt hattest und für das du mehr Zeit als für jedes andere aufgewendet hattest – mehrere Monate –, endgültig beendet war. Jede weitere Retusche würde es verderben. War es nicht dumm, daß du das beste Bild deines fünfzigjährigen Lebens auf einer Sackleinwand gemalt hattest, die durch die Feuchtigkeit und den Regen in kurzer Zeit verrotten würde? Er dachte: ›Macht es etwas aus, wenn es verschwindet, ohne daß jemandes gesehen hat? Es würde ohnehin niemand erfassen, daß es sich um ein Meisterwerk handelt.‹ Niemand würde es verstehen. Wie war es möglich, daß nicht einmal Daniel de Monfreid dir geschrieben hatte, dieser treue Freund, den du vor drei Monaten mit der Verzweiflung eines Ertrinkenden um Hilfe gebeten hattest?
Er erreichte Punaauia gegen Mittag. Zum Glück waren Pau’ura und der kleine Emile nicht zu Hause. Nicht, weil sie deine Pläne hätte durchkreuzen können, denn das Mädchen war als echte Maori daran gewöhnt, ihrem Ehemann in allem zu gehorchen, was dieser tat oder wollte, sondern weil du mit ihr hättest sprechen und ihre dummen Fragen beantworten müssen, und jetzt hattest du weder Zeit noch Bereitschaft oder Geduld für Dummheit. Und schon gar nicht für das Geschrei des Kindes. Er dachte daran, wie intelligent Teha’amana gewesen war. Mit ihr zu reden hatte dir geholfen, stürmische Zeiten zu überstehen; mit Pau’ura nicht. Er kletterte die schwankende Außentreppe der Hütte zum Schlafzimmer empor, auf der Suche nach der Tüte mit dem Arsenikpulver, mit dem er sich die Wunden an den Beinen einrieb. Er nahm seinen Strohhut und den Stock, in dessen Griff er einen steifen Phallus
Weitere Kostenlose Bücher