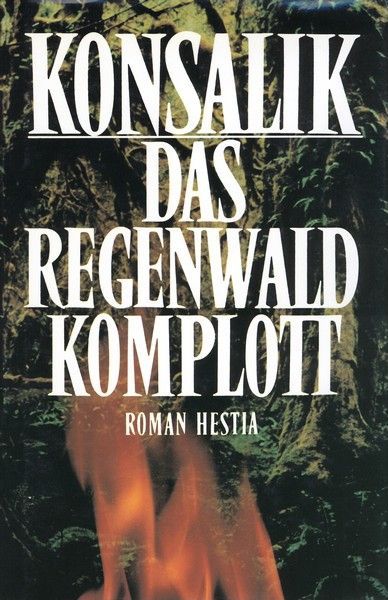![Das Regenwaldkomplott]()
Das Regenwaldkomplott
Palermo, war schon zweimal da in Urlaub.«
»– in einem Krankenhaus im OP geholfen. Nicht am OP-Tisch, ich mußte neue Tücher, Mull, Tupfer und andere Sachen reichen und bei Amputationen die abgeschnittenen Körperteile wegschaffen. Aber ich habe viel dabei gesehen und behalten. Ich könnte Ihnen helfen, Doktor.«
»Das ist ja fabelhaft, Luigi. Ich werde dir beibringen, wie man Klemmen setzt und Tuchhalter und Wundspreizer. Du kannst mir wirklich eine große Hilfe sein. Und Schwester Lucia wird das Instrumentarium übernehmen. Ihr werdet sehen: Gemeinsam machen wir ein richtiges Krankenhaus aus der Station.«
»Wenn Sie Ihre Kisten aus Boa Vista bekommen.«
»Das hat Senhor Beja versprochen.«
»Versprochen.« Luigi verzog höhnisch den Mund. »Der hat schon viel versprochen und ganz wenig davon gehalten. Wenn nun die Kisten nicht ankommen oder erst in ein paar Wochen?«
»Dann operiere ich mit dem, was ich hier habe.« Thomas verließ das Krankenzimmer, der Yanomami starrte ausdruckslos an die Decke. »Mein Großvater hat mir oft erzählt, unter welchen Bedingungen sie im Krieg an der Front arbeiten mußten. Und erst recht in der Gefangenschaft. Dagegen sind wir hier ausgestattet wie eine Uni-Klinik. Und was mein Großvater damals konnte, das muß auch ich heute können. Daran denke ich immer.«
»Damals war der Tod alltäglich. Aber wenn ein Yanomami unter Ihren Händen, unter den Händen eines Weißen stirbt – eines Termitenmenschen, wie sie uns nennen, weil wir uns wie die Riesenameisen durch den Wald fressen und alles zerstören –, dann gnade uns Gott. Dann kann niemand Sie mehr retten vor den Giftpfeilen der Indios.«
»Das hat mir Pater Ernesto schon gesagt. Er ist, du hast's ja gehört, jetzt unterwegs zu den Patas.« Thomas folgte einem plötzlichen Impuls und legte seinen Arm um die Schulter Luigis. »Luigi, keine Angst, wir schaffen es.«
»Ich bin dann nämlich auch dran, weil ich Ihnen geholfen habe, Doktor.«
»Es wird nichts passieren. Es wird alles gutgehen. Über so eine Bruchoperation verliert man bei uns kein Wort. Das ist reine Routine. So schnell sterben wir nicht, Luigi.«
Während Schwester Lucia Bananenbrei, Mangos und Fladen aus Maismehl als Frühstück an die Kranken verteilte, ging Thomas hinüber zu dem Flachbau, in dem Luise wohnte.
Sie hatte ihr Labor fast fertig eingerichtet und war dabei, die letzten Kolbenständer und Glasschlangenhalter zu montieren. Sie blickte hoch, als die Tür aufging und Thomas eintrat.
»Hallo«, sagte sie. »Morgen geht es los. Morgen tauche ich im Regenwald unter.«
»Allein? Unmöglich!«
»Pater Vincence hat mir zugesichert, daß mich vier Yanomami begleiten, die den Wald wie ihren Bauchnabel kennen. Tom, du brauchst keine Angst zu haben. Aber –« Sie ging auf ihn zu und gab ihm einen langen Kuß. Er umarmte sie, so fest, daß sie nach Luft schnappte, »– wir werden uns bestimmt eine Woche lang nicht sehen.«
»Du willst im Wald bleiben?«
»Anders geht es doch nicht. Ich muß in den Teil des Dschungels kommen, den noch kein Mensch betreten hat. Ich muß entdecken, Liebling. Ich muß Neuland betreten.«
Sie sagte es so selbstverständlich, als erzähle sie, daß sie am Nachmittag zu einem Schaufensterbummel in die Innenstadt fahren wolle. Thomas behielt sie in seinen Armen und blickte ihr in die tiefblauen Augen.
»Ich habe Angst«, sagte er ehrlich. »Ganz verrückte Angst.«
»Warum? Es ist meine Aufgabe, ihretwegen bin ich an den Rio Parima geschickt worden. Wenn du nicht hier wärst, hätte keiner Angst um mich.«
»Aber ich bin hier. Und ich liebe dich. Wenn ich nur darüber nachdenke, daß du allein mit vier Yanomami im unbekannten Regenwald … Mein Gott, ich will mir nicht ausmalen, was alles passieren kann. Es würgt mir die Luft ab. Li, warte noch ein paar Tage. Der Wald läuft dir nicht weg. Er steht seit Millionen Jahren dort. Keiner drängt dich, daß du schon morgen mit deinen Forschungen beginnst.«
»In ein paar Tagen haben wir dieselbe Situation.«
»Nein. Dann kann ich dich begleiten.«
»Tom, du gehörst zu den Kranken und nicht zu bisher unbekannten Lianen und Orchideen. Was willst du denn im Wald tun?«
»Dir helfen und dich beschützen.«
»Wer sollte mir etwas antun?« Sie befreite sich aus seinen Armen und trat einen Schritt zurück. »Tiere? Die Indios wittern sie eher als sie mich. Der größte Feind des Menschen ist der Mensch. Und wo ich hingehe, gibt es keine Menschen. Ich werde der erste
Weitere Kostenlose Bücher