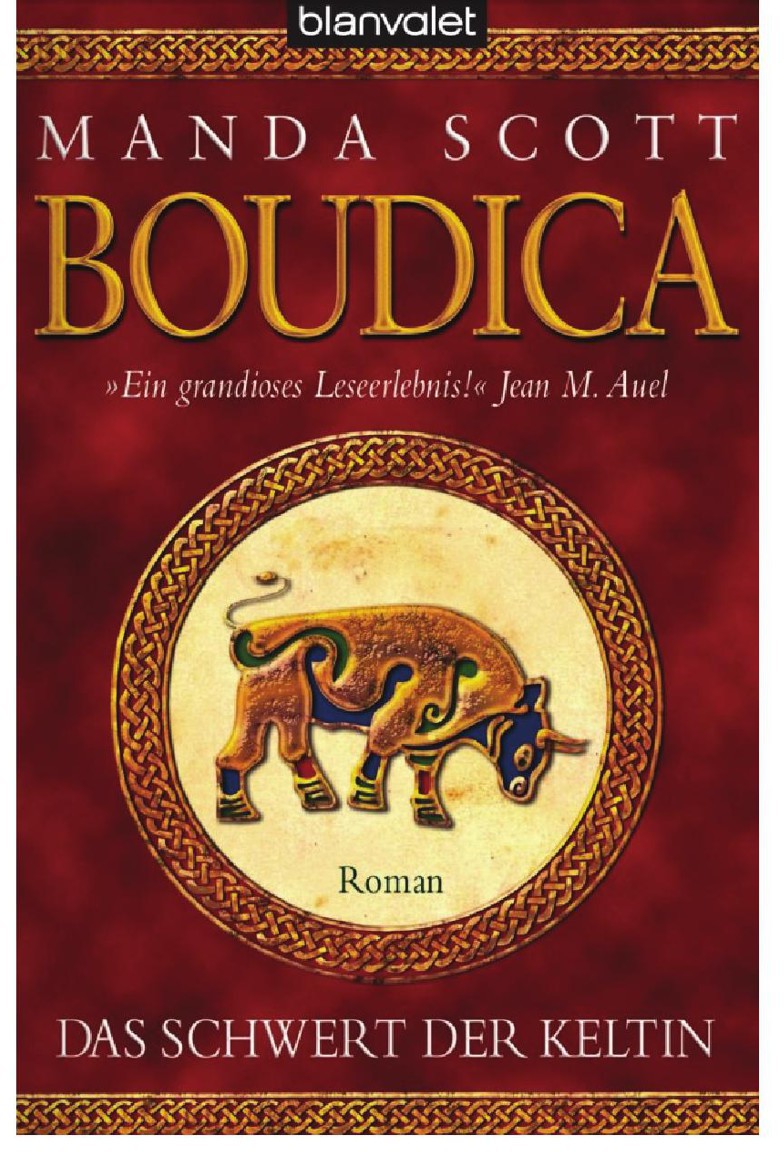![Das Schwert der Keltin]()
Das Schwert der Keltin
mit einer bestimmten Absicht geschehen war.
Er stürzte seinen Becher Wein hinunter und goss sich gleich darauf einen neuen ein. Ein wenig göttlicher Beistand oder ein ebensolcher Ratschlag wären ihm in diesem Augenblick durchaus gelegen gekommen, doch in der letzten Zeit erschien Mithras nur noch selten, und wenn Valerius sich in Gesellschaft befand, zumeist gar nicht. Seit seiner eigenen Brandmarkung hatte er nun schon den Initiationsriten von mehr als einhundert Mitbrüdern beigewohnt. Manchmal war er dabei derjenige gewesen, der die Kordeln um die Handgelenke durchschnitten oder die Lampen entzündet hatte, oder er hatte den Gesang angestimmt. In jedem Fall aber hatte er gesehen, wie zahllose Männer den Weg zu Mithras fanden, und er hatte die auf diese Weise in ihnen hervorgerufenen Veränderungen beobachtet - und dies nicht nur in jenem Kellergewölbe, sondern auch auf dem Schlachtfeld und den Exerzierplätzen. Diese Männer waren erstrahlt unter der Berührung der Gottheit, und ein jeder von ihnen glaubte, dass Valerius dieses Gefühl mit ihnen teilte. Theophilus aber kannte die Wahrheit dahinter, und somit musste Valerius davon ausgehen, dass auch Xenophon sie kannte; dass auch er wusste, dass die Besuche der Gottheit eine im Grunde bloß sehr seltene Angelegenheit waren und dass durch all die unfruchtbaren Jahre hindurch allein die Hoffnung und das Vertrauen auf das einstige Wunder und eine verworrene Ansammlung unzusammenhängender Träume diese seltenen Begegnungen mit dem Gott überhaupt noch ermöglichten.
Dennoch hatte selbst dieses Wissen Valerius niemals davon abhalten können, weiterhin nach einer Berührung der Sonne und alledem, wofür diese noch stand, zu streben. Auch jetzt drängte er mit aller Macht zu seinem Gott und war gleich darauf zuerst erstaunt und dann dankbar dafür, dass das Bild Xenophons nun tatsächlich langsam zu verschwimmen begann und sich stattdessen jene ersehnten anderen Welten in sein, Valerius’ Bewusstsein zu schieben schienen. Als Erstes tauchte vor ihm der rot schimmernde Stier auf, und zwar ganz genau so, wie er es immer tat, seit Valerius ihn einst in Fleisch und Blut hatte bewundern können. Valerius begegnete dem Stier wie einem alten Freund - wie seinem einzigen, wahren Freund -, und einhergehend mit der Kraft des Bullen erstellte er im Geiste einen quaderförmigen Altar für seinen einen Gott und fügte, um die Vision noch realer erscheinen zu lassen, mit Hilfe seiner Vorstellungskraft auch noch den Weihrauch und den Brandgeruch hinzu. Auf den meergrünen Verputz hinter Xenophons Kopf malte er das Bild des mit einer Kapuze vermummten Jünglings, der auf das Geheiß der älteren, wütenderen Götter hin gerade ein wahres Blutbad anrichtete: Der strahlende Stier starb, auf die Knie gezwungen, und der junge Gott weinte. Seine Tränen vermischten sich mit dem Blut des Stieres und tropften auf den Sandstein. Sofort beanspruchten die bereits versammelten Geister diese für sich.
Valerius starrte seinen Gott an, und sein Gott blickte wiederum auf ihn nieder, und den zwischen ihnen noch verbliebenen Raum erfüllten die schreienden Geister der schon lange und der erst kürzlich Verstorbenen. Xenophon wartete noch immer schweigend. In jenem Moment jedoch, in dem Valerius in seiner neuen Welt förmlich zu versinken schien, trat Xenophon zu ihm hinüber und ließ sich neben ihm auf den Boden sinken. Der Dekurio spürte, wie eine schmale, zerfurchte Hand sich auf seine Stirn legte und eine andere sein Handgelenk anhob und den Puls fühlte. Eine Stimme, die von jenseits aller Zeiten herüberzuschallen schien, fragte: »Was siehst du?«
»Nichts.« Davon würde er nie wieder einem Menschen etwas erzählen.
»Dann bist du also blind?«
»Nein.« Valerius legte die Hände über die Augen. Manchmal half diese Dunkelheit, manchmal machte sie die Dinge auch nur noch schlimmer. Dieses Mal aber schenkte sie ihm ein wenig Raum, um jene Worte hervorzulocken, die er sich in der Befürchtung eines solchen Angriffs schon halb zurechtgelegt hatte. Als er schließlich wieder mit fester Stimme sprechen konnte, begann er: »Theophilus ist von Beruf Arzt. Er sieht die Welt folglich mit anderen Augen als jene unter uns, die die Disziplin unter den kämpfenden Männern aufrechterhalten müssen. Umbricius hatte mich öffentlich angegriffen; ich hatte ihn in Notwehr getötet. Meine Truppe und auch die seine waren Zeugen. Und niemand hat das je in Frage gestellt.«
»Aber der Rest? Die
Weitere Kostenlose Bücher