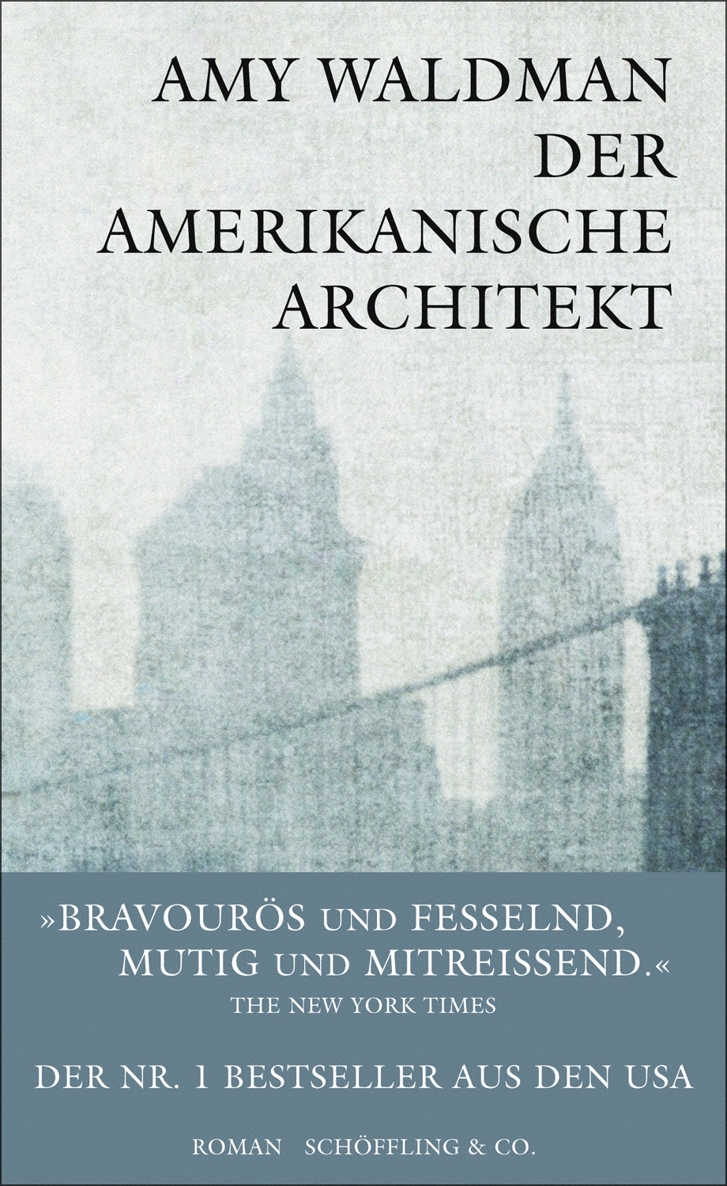![Der amerikanische Architekt]()
Der amerikanische Architekt
ich bin daran gewöhnt.« Genau das war es, was seine Mutter gefürchtet hatte. Er drehte sich halb um, um ihren Gesichtsausdruck nicht sehen zu müssen.
»Vielleicht zu sehr daran gewöhnt«, sagte Salman. In ausgehungerter Erwartung des Sonnenuntergangs hatte er Mos Kühlschrank geöffnet und die verräterischen weißen Kartons mit den Resten chinesischer, indischer und thailändischer Take-away-Mahlzeiten entdeckt, mit denen Mo tagtäglich das Fasten beendete. »Das Fastenbrechen sollte etwas Gemeinschaftliches sein«, sagte sein Vater. »Take-away-Sachen, die man ganz für sich allein isst, sind nicht damit gemeint.«
Mos Rücken versteifte sich. Er wollte sich nicht so sehen, wie sein Vater ihn zeichnete. »Dann ist es ja gut, dass wir beim Bürgermeister eingeladen sind«, sagte er kurz angebunden.
»Mo, du weißt, dass wir stolz auf dich sind. Aber wir sind auch besorgt.« Salman hatte am Telefon schon oft Ähnliches gesagt, aber sein Gesichtsausdruck sprach eine viel deutlichere Sprache. »Der Preis dafür, diese Sache durchboxen zu wollen – er ist zu hoch.«
Mo war nicht wirklich überrascht. Sein Vater hatte viele mutige Entscheidungen getroffen: nach Amerika zu kommen, um zu studieren, die Frau seiner Wahl zu heiraten – dazu auch noch eine Künstlerin –, statt die Frau, die seine Eltern für ihn ausgesucht hatten, die Tradition zugunsten der Moderne aufzugeben. Aber dann hatte er sich, wie Mo es sah, doch den Konventionen angepasst. Schon dass Mo Architekt werden wollte, hatte Salman beunruhigt. Die bevorzugten Berufsbereiche für einen indischen Sohn waren Wirtschaft, Medizin oder eine akademische Laufbahn, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Oder Maschinenbau. Architektur war ein eher schlecht bezahltes Betätigungsfeld, in dem Erfolg, es sei denn, er war spektakulär, schwer zu messen war. Aber als Mos Talent sich immer deutlicher zeigte, als Gebäude, an denen er beteiligt war, tatsächlich gebaut wurden, verwandelte sich Salmans Sorge in Stolz, und er prahlte überall mit den Arbeiten seines Sohnes. Aber Mo hatte seine ursprünglichen Bedenken nie vergessen.
»Der Preis dafür, sie nicht durchzuboxen, ist auch hoch. Ich kann nicht einfach aufgeben.«
»Du ziehst zu viel Aufmerksamkeit auf dich, auf uns – auf uns alle, alle Muslime in Amerika. Es könnte gefährlich werden«, sagte Salman. Die Hände auf dem Rücken verschränkt, ging er auf und ab. »Meine Moschee hat einen Wachmann engagiert, weil Drohungen eingegangen sind, und ich habe fast das Gefühl, dass ich die Kosten dafür übernehmen müsste. Du musst auch an die Gemeinschaft denken.«
Dass Salman neuerdings regelmäßig in die Moschee ging, wollte Mo nicht in den Kopf. Aber irgendwann nach den Anschlägen hatte Salman, der sein ganzes Erwachsenenleben hindurch jeder Art von Religion gleichgültig, wenn nicht gar feindselig gegenübergestanden hatte, angefangen zu beten. Erst allein, dann in der Moschee. »Aus Neugier«, hatte er gesagt, als Mo ihn danach fragte. »Oder vielleicht auch aus Solidarität.« Als er ein paar Monate später noch einmal fragte, hatte Salman geantwortet: »Weil ich glaube.« Mo hatte nicht gewusst, was er dazu sagen sollte.
»Welche Gemeinschaft, Baba? Meine Gemeinschaft sind Menschen wie ich. Menschen, die rational denken.«
»Aber selbst einige dieser ach so rationalen Menschen fragen sich, ob das, was du tust, richtig ist«, sagte Salman. »Selbst einige dieser Leute geben zu, dass sie uns nicht hundertprozentig trauen. Und das ist das Gefährlichste überhaupt.« Salman setzte sich neben Shireen auf den Koffer, der unter ihrem gemeinsamen Gewicht nachgab. Sie sahen aus, als warteten sie darauf, eingepackt und ins Exil verschifft zu werden. Einen Augenblick später stand Salman schwerfällig auf und setzte seine Wanderung durchs Zimmer fort.
»Deine Mutter und ich haben neulich über deinen Namen gesprochen«, fing er an. »Wieso haben wir dir ausgerechnet den Namen Mohammad gegeben, den muslimischsten Namen, den man sich nur vorstellen kann? Natürlich weil es der Name deines Großvaters war und er alles verkörperte, was wir uns für dich wünschten. Seine Frömmigkeit war sprichwörtlich, aber vor allem war er einfach ein guter Mensch. Aber dein Name war auch Ausdruck unseres Glaubens an dieses Land. Wir hätten dir einen typisch amerikanischen Namen geben können, aber obwohl wir der Religion den Rücken zuwandten, verleugneten wir nie, dass wir Muslime sind. Wir glaubten so fest an
Weitere Kostenlose Bücher