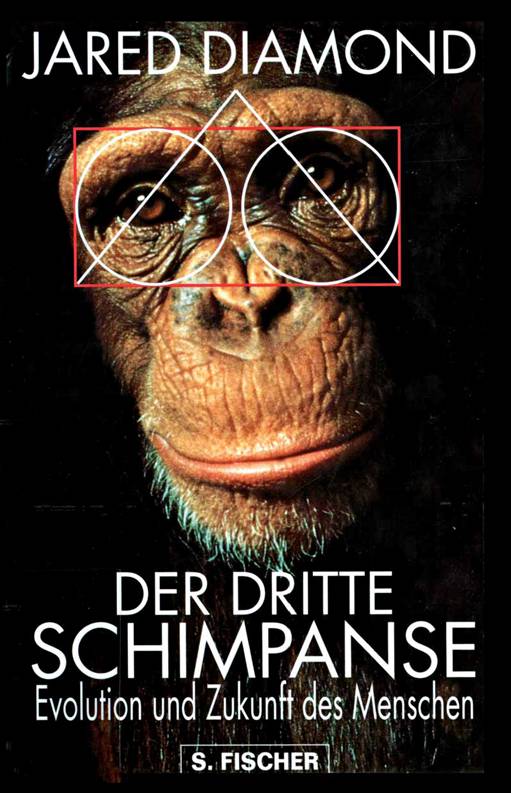![Der dritte Schimpanse]()
Der dritte Schimpanse
grö-ßere Investition als bei Schimpansen oder Orang-Utans. Menschliche Väter tragen somit viel mehr zur Aufzucht ihres Nachwuchses bei als nur das Sperma, auf das sich der väterliche Beitrag eines Orang-Utans beschränkt.
Auch in weniger auffälligen, jedoch keineswegs irrelevanten Aspekten unterscheidet sich unser Lebenszyklus von dem wilder Menschenaffen. Viele von uns leben länger als die meisten Affen. Selbst bei Stämmen, die ihr Dasein als Jäger und Sammler fristen, gibt es Alte, die als Erfahrungsspeicher und Wissensfundgrube eine höchst wichtige Funktion innehaben. Die Hoden des Mannes sind wesentlich größer als beim Gorilla, aber kleiner als beim Schimpansen, wofür ich die Gründe in Kapitel 3 erläutern werde. Uns erscheinen die Wechseljahre der Frau, das Klimakterium, als etwas Unvermeidliches, und ich werde in Kapitel 7 zeigen, warum sie für Menschen sinnvoll, unter den übrigen Säugetieren aber fast ohnegleichen sind. Die engste Parallele besteht zu einigen Arten winziger, mäuseähnlicher Beuteltiere in Australien, bei denen es allerdings die Männchen sind, die das Klimakterium durchlaufen. Mithin zählten auch Langlebigkeit, Hodengröße und Klimakterium zu den Voraussetzungen der Menschwerdung.
Wieder andere Merkmale unseres Lebenszyklus unterscheiden sich weitaus drastischer von dem der Menschenaffen als unsere Hoden, wobei die Funktion dieser neuartigen Charakteristika noch heiß umstritten ist. Wir entsprechen sicher nicht der »Norm« im Tierreich, wenn wir uns zum Geschlechtsverkehr in der Regel zurückziehen und ihm dann frönen, wenn wir gerade Lust haben, statt vor den Augen der anderen und nur dann, wenn die Frau zur Empfängnis bereit ist. Weibliche Menschenaffen lassen keinen Zweifel aufkommen, wann sie einen Eisprung haben, während Frauen diesen Vorgang sogar vor sich selbst verbergen. Anatomen verstehen zwar die Bedeutung der bescheidenen Hodengrö-ße der Männer, haben aber keine Erklärung für die relativ enorme Größe des Penis. Was all diese Merkmale auch immer bedeuten mögen, sind sie doch ebenfalls Elemente dessen, was das Menschsein ausmacht. Gewiß können wir uns nur schwer vorstellen, wie Väter und Mütter ihre Kinder in harmonischer Gemeinsamkeit aufziehen sollten, wenn die Frauen einigen Primatenweibchen darin glichen, daß sich ihre Genitalien zur Zeit des Eisprungs leuchtend rot verfärbten, sie nur zu diesem Zeitpunkt sexuell empfänglich wären, das Symbol ihrer Empfänglichkeit stolz zur Schau stellten und vor aller Augen mit jedem in Reichweite befindlichen Mann sexuell verkehrten.
Unser gesellschaftliches Zusammenleben und die Kinderaufzucht basieren also nicht allein auf den in Teil I geschilderten Skelettveränderungen, sondern auch auf den bemerkenswerten neuen Merkmalen unseres Lebenszyklus. Anders als bei den Knochen können wir jedoch die Zeitpunkte solcher Veränderungen im Laufe unserer Evolutionsgeschichte nicht zurückverfolgen, da sie keine direkten fossilen Spuren hinterließen. Aus diesem Grunde widmen paläontologische Schriften diesem Thema trotz seiner Bedeutung nur geringe Aufmerksamkeit. Archäologen entdeckten kürzlich den Zungenknochen eines Neandertalers, einen der wichtigsten Bestandteile unseres Sprechapparates ; von einem Neandertaler-Penis fehlt jedoch bislang jede Spur. Wir wissen nicht, ob der Homo erectus , dessen großes Gehirn durch Funde gut belegt ist, bereits einen Hang zum Geschlechtsverkehr im Verborgenen entwickelte.
Wir können nicht einmal, wie im Falle der Gehirngrö-ße, mit Hilfe von Fossilien beweisen, daß der menschliche Lebenszyklus stärker von dem unserer Urahnen abweicht als der Lebenszyklus der heute lebenden Menschenaffen. Vielmehr müssen wir uns damit begnügen, diesen Schluß daraus zu ziehen, daß unser Lebenszyklus nicht nur im Vergleich zu dem der heutigen Menschenaffen, sondern auch im Vergleich zu anderen Primaten eine seltene Ausnahme darstellt.
Darwin fand Mitte des 19. Jahrhunderts heraus, daß die Anatomie der Tiere das Ergebnis einer Evolution durch natürliche Selektion (»Zuchtwahl«) darstellt. Biochemiker unseres Jahrhunderts verfolgten ganz analog, wie sich durch natürliche Selektion die chemische Beschaffenheit der Tiere entwickelte. Der gleiche Selektionsmechanismus prägt aber auch das Verhalten der Tiere, insbesondere im Bereich der Fortpflanzung und der sexuellen Gewohnheiten. Wie wir noch sehen werden, gibt
Weitere Kostenlose Bücher