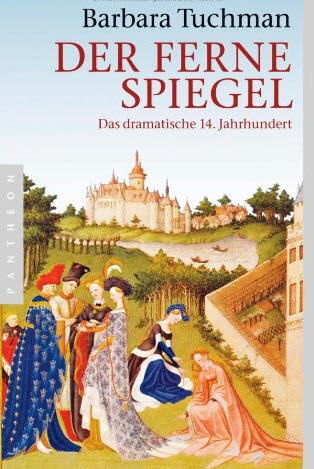![Der ferne Spiegel]()
Der ferne Spiegel
kuttenartigen Kapuzen aus schwerem Stoff, die gegen die Kälte getragen wurden, finden sich in den Berichten aller Beobachter. Gügler genannt (nach dem schwyzerdeutschen Ausdruck für Spitze oder Kutte), gaben die Kapuzen dem »Güglerkrieg« seinen Namen.
Vor seinem Aufbruch sorgte Coucy in großer Manier für die Zukunft seiner Seele, falls er fallen sollte. Er bezahlte zwei Messen »jeden Tag und für immer« in der Abtei Nogent-sous-Coucy für sich selbst, seine Vorfahren und seine Nachfolger. Seine Instruktionen, wie die meisten dieser Art, waren präzise und sehr spezifiziert, nichts wurde dem Zufall überlassen. Die Gebete sollten vor dem Bild der Notre-Dame in der Kapelle gesprochen werden, an dem Ort, der bereits zur Begräbnisstätte für Coucy und seine Frau bestimmt war. Er gab den Mönchen von Nogent das exklusive
Recht am Fischfang im Fluß Ailette im Bereich zwischen der Rue de Brasse und der Brücke St. Mard.
Während seine vereinigte Streitmacht bereits ins Elsaß eingefallen war und das Land sechs Wochen lang im Oktober und November ausplünderte, hatte Coucy sein Kommando immer noch nicht angetreten. Diese Verzögerung ist eines der vielen Rätsel dieses seltsamen Winterkriegs. Verlegte er seine Ankunft bewußt, um die Chance zu erhöhen, daß der Winter die Kompanien hart traf und ihre Zahl verminderte? Die Tatsache, daß auch Du Guesclin 1365 seinen Marsch über die Pyrenäen erst im Dezember antrat, deutet auf ein Verhaltensmuster. Andererseits war Coucy fest entschlossen, tatsächlich Krieg gegen den Vetter seiner Mutter, Leopold, zu führen und seine Armee nicht einfach im Bergschnee des Jura untergehen zu lassen. [Ref 222]
Im späten September hatte er dem kaiserlichen Vogt im Elsaß, dem Herzog von Brabant, geschrieben, daß er beabsichtigte, den Breisgau, Sundgau und den kleinen Bezirk Pfort zu beanspruchen, und hatte die Versicherung erhalten, daß keine kaiserlichen Maßnahmen gegen seinen Versuch, sich Gerechtigkeit zu verschaffen, zu erwarten wären. Um seinen Feldzug zu einem gerechten Krieg zu erklären und sich von einem bloßen Hauptmann von Söldnern abzuheben, schrieb Coucy auch an die Städte Straßburg und Kolmar, sicherte ihnen zu, daß er sie nicht bedrohte, erklärte seinen Anspruch gegen den Habsburger und ermahnte sie, keine Furcht zu zeigen, sondern seine gerechten Forderungen zu unterstützen. Das blieb unbeantwortet, da unter den Stadtmauern seine Söldner bereits ihre Greueltaten verrichteten.
Wenn der Aufschrei des Entsetzens in den örtlichen Chroniken als Evidenz gelten kann, hat es im Elsaß nie ein schlimmeres Massaker gegeben. Vierzig Dörfer im Sundgau wurden ausgeraubt und zerstört, hundert Einwohner von Wattwiller ohne Gnade umgebracht, Männer und Frauen ergriffen, um den Briganten zu dienen, die Franziskanerabtei von Thann bis auf die Grundmauern niedergebrannt, das Kloster von Schönensteinbach so verwüstet, daß es aufgegeben werden mußte und seine Felder erst zwanzig Jahre später wieder bebaut wurden. Die Kompanien erpreßten den üblichen
Tribut, den die Reichen in Geld, Pferden, schönen Stoffen, die Armen in Schuhen, Hufeisen und Nägeln zahlten. Wenn sie nach dem Ziel des Feldzugs gefragt wurden, antworteten einige Hauptleute angeblich, daß sie »um 60 000 Florins, sechzig Streithengste und sechzig Goldgewänder« gekommen wären. Der Bischof und der Magistrat von Straßburg zahlten 3000 Florins, um die Stadt vom Angriff freizukaufen.
Am Beginn des Feldzugs hatten die Hauptleute in Coucys Sold noch versucht, die Disziplin aufrechtzuerhalten, und einige hängten jeden Tag Schuldige, um die Unordnung zu ersticken. Aber unter Männern, die an gesetzlose Gewalttätigkeit gewöhnt waren, konnten auch härteste Strafen die Gewalt nicht kontrollieren.
Angesichts der Invasion übernahm Leopold die gleiche Strategie wie Karl V.: Er befahl den Elsässern, alles zu zerstören, was dem Feind helfen, ihn schützen oder ernähren konnte, und sich mit ihrem Hab und Gut in die Städte und festen Burgen zurückzuziehen. Wie Karl befahl er die Befestigung von Städten, die Zerstörung von anderen, die nicht zu verteidigen waren, und das Verbrennen von entfernteren Dörfern. Auf dem Papier sind solche Befehle leicht zu geben; in der Praxis ist es kaum vorstellbar, daß ein Bauer die Frucht seiner Arbeit, das Getreide, das ihn im nächsten Jahr ernähren sollte, zerstört hätte. Es ist schwer abzuschätzen, in welchem Ausmaß diese Befehle tatsächlich
Weitere Kostenlose Bücher