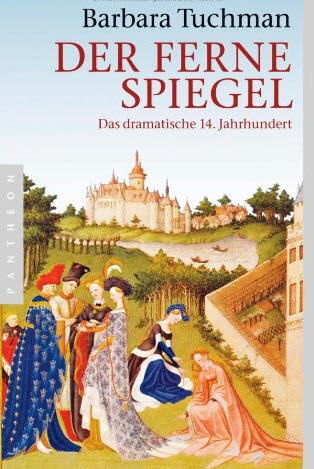![Der ferne Spiegel]()
Der ferne Spiegel
Schismas durch die Gewalt der Waffen. Der Plan eines Marsches auf Rom und der Absetzung des Papstes Bonifatius IX. zugunsten des Papstes Klemens VII. wurde der Voie de Fait oder Weg der Tat, der Gewalt genannt – im Gegensatz zum Weg der Abtretung, des freiwilligen Verzichts beider Päpste, für den die Universität von Paris eintrat. Durch Italien zu marschieren und Rom zu erobern, war kein geringeres Unternehmen als die Invasion Englands – die sich noch vor kurzem als die französischen Kräfte übersteigend erwiesen hatte –, aber die Politiker in Paris ließen sich davon nicht abschrecken. Der königliche Rat faßte diesen Beschluß Ende November innerhalb weniger Tage nach der Rückkehr Coucys und Bourbons aus Tunesien. [Ref 362]
Der Plan wurde dem König als ein Vorspiel zum Kreuzzug unterbreitet. Er konnte nicht guten Gewissens, sagten ihm seine Berater, das Kreuz nehmen, solange die Kirche nicht vereinigt sei. »Wir können uns für Euch nichts Großartigeres und Vernünftigeres vorstellen, als mit der Macht der Reisigen nach Rom zu ziehen und diesen Gegenpapst Bonifatius zu vernichten . . . Nichts Besseres könntet Ihr unternehmen. Wir dürfen hoffen, daß dieser Gegenpapst und seine Kardinäle sich, wenn sie hören, daß Ihr kommt, Eurer Gnade ausliefern werden.« Nach Vollendung dieser ruhmreichen Tat wäre dann die Zeit gekommen, das strahlende Ziel Jerusalem ins Auge zu fassen.
Wann konnte er aufbrechen? fragte der König, sofort Feuer und
Flamme. Er war unter dem kriegerischen Einfluß Mézières’ aufgewachsen, der den Hof mit seiner Propaganda für den Kreuzzug als Bestimmung Frankreichs erfüllt hatte. Die Räte des Königs sagten, daß die Vorbereitungen sofort beginnen könnten, und die Planungen wurden auf der Stelle in Gang gebracht. Das ganze königliche Haus sollte teilnehmen; selbst der Herzog der Bretagne, Montfort, wurde eingeladen, weil »sie es nicht für umsichtig hielten, ihn zurückzulassen«. Er sagte unfreundlich voraus, daß das Unternehmen »in Worten enden« würde.
Eine gewaltige Streitmacht von zwölftausend Lanzen sollte, beschloß man, aufgestellt werden, der Aufbruch wurde auf den März 1391, in vier Monaten also, festgelegt. Die Armee sollte sich in Lyon sammeln. Der König und sein Bruder sollten viertausend Lanzen anführen; Burgund, Berry und der Constable je zweitausend; Bourbon und Coucy jeder tausend; alle sollten drei Monate Sold im voraus erhalten. An die Steuern, die notwendig waren, um eine solche Armee aufzustellen, scheint kaum ein Gedanke verschwendet worden zu sein; die Finanzierung des Unternehmens war genauso unrealistisch wie der Weg der Tat selbst. Als der königliche Rat zusammentrat, um die Steuern zu autorisieren, ließ ein Omen in der Form eines schrecklichen Gewitters die Ratsherren zögern. War es ein Zeichen Gottes gegen die neuen Bürden, die einem überlasteten Volk auferlegt werden sollten?
Die Stimme der Universität sprach deutlicher gegen den Weg der Tat als Blitz und Donner. In einer erstaunlichen zwölfstündigen Predigt vor dem König und dem Hof sprach am 6. Januar 1391 Johann Gerson, ein junger, aber schon berühmter Geistlicher, gegen das Unternehmen. Siebenundzwanzig Jahre alt und noch zwei Jahre vom Doktorgrad der Theologie entfernt, war Gerson ein Schützling des Kanzlers Pierre d’Ailly, dessen Nachfolge er bald antreten sollte. Als der Kampf um das Schisma an Intensität zunahm, sollte er der bedeutendste Fürsprecher der Suprematie des Kirchenkonzils über den Papst werden und der größte französische Theologe seiner Zeit. [Ref 363]
Gerson war ein Mann, der sich jeder Einordnung oder verallgemeinernden Typisierung entzieht. Von seiner religiösen Auffassung her ein Mystiker, war er in der politischen Praxis ein Rationalist.
Er schätzte den goldenen Mittelweg und mißtraute den frommen Exzessen anderer Mystiker und Visionäre. Als Kirchenmann war er sowohl konformistisch wie nonkonformistisch. Human in seinen Ideen, wandte er sich in der großen Debatte über den Rosenroman schroff gegen die frühen französischen Humanisten. Trotz seiner Abneigung gegen Visionäre, besonders weibliche, sollte er im letzten Jahr seines Lebens zu einem von nur zwei Theologen zählen, die an die Authentizität der Stimmen der Jeanne d’Arc glaubten – nicht deshalb, weil er das war, was man, modern ausgedrückt, einen Liberalen nennen würde, sondern weil er die Intensität ihres Glaubens verstand. Er war ein Kompendium und zugleich ein
Weitere Kostenlose Bücher