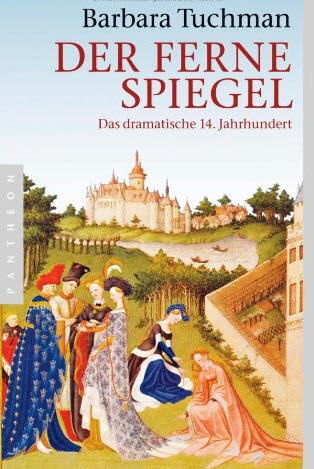![Der ferne Spiegel]()
Der ferne Spiegel
Leute, ins Feuer!«
Bewunderer de Meungs sprangen ihm in offenen Briefen an Christine und Gerson bei. Die Verteidiger, Jean de Montreuil, Gontier und Pierre Col, waren Geistliche und Gelehrte im Dienst der Krone. Gemeinsam mit gleichgesinnten Akademikern zählten sie zu jenen, die eine andere Antwort auf die staubigen Probleme der Scholastik gesucht hatten als Gerson. Mit ihrem Glauben an die menschliche Vernunft und ihrer Anerkennung der natürlichen Triebe kamen sie einer weltlichen Daseinssicht sehr nahe und waren in diesem Sinne Humanisten, auch wenn sie sich nicht mit der Erforschung der Klassik – wie die humanistische Bewegung in Florenz – beschäftigten. In de Meung bewunderten sie die Freiheit des Gedankens und die kühnen Angriffe auf die festgeschriebenen Formeln der Zeit. Unter bestimmten gelehrten und aufgeklärten Menschen, unterstrich Jean de Montreuil, war die Bewunderung für den Rosenroman so groß, daß sie lieber ihr Hemd weggegeben hätten als dieses Buch. »Je tiefer ich in die ernsten Geheimnisse und die geheimnisvolle Ernsthaftigkeit dieses tiefen und berühmten Werkes eindringe, desto mehr wundere ich mich über Eure Mißbilligung.« [Ref 366]
Das war zwar inbrünstig ausgedrückt, zugleich aber auch sehr vage. Pierre Col war mutiger, er verteidigte offen die Sinnlichkeit, die Gerson so anstößig fand. Er bestand darauf, daß das Hohe Lied Salomos die Liebe zu einer Tochter des Pharao, nicht zur Kirche, verherrliche; daß die weibliche Vulva, deren Symbol die Rose war, nach dem Lukasevangelium als heilig galt; und daß Gerson selbst sich eines Tages verlieben würde – was auch anderen Theologen schon geschehen sei.
Die Debatte weitete sich aus. Christine antwortete mit Le Dit de la Rose , Gerson mit einem gelehrten Essay, Tractatus Contra Romantium de Rosa , in dem allegorische Gestalten ihre Klagen gegen Jean de Meung einem »heiligen Gerichtshof der Christenheit« vortragen, der ihn daraufhin angemessen verurteilt. Obwohl Gerson im Streit das letzte Wort hatte, konnte er die Anziehungskraft des Buches nicht brechen. Es wurde bis ins 16. Jahrhundert hinein viel gelesen und überlebte sogar einen frommen Versuch, seine Symbole und Bilder zu »moralisieren« – die Rose wurde in eine Allegorie Jesu verwandelt. [Ref 367]
Während Gerson im Rahmen der etablierten Kirche blieb, zog die Suche nach dem Glauben andere Bewegungen weg von der institutionellen Religion. Viele Menschen suchten in Laiengemeinden einen Ersatz für Rituale, die in ihren Augen leblos und korrupt geworden waren. Der Glaube wurde um so notwendiger, als die Gesellschaft sich in einem dunklen Wald von Schrecken und Wirren verirrt zu haben schien.
Die zerstörerische Wirkung des Schismas hatte sich vertieft. Beide Päpste suchten einander in der Extravaganz ihrer Prachtentfaltung zu übertreffen, und sie brauchten mehr und mehr finanzielle Mittel, um diesen auf Prestige zielenden Aufwand aufrechterhalten zu können. Papst Bonifatius IX. beteiligte sich an Wuchergeschäften und verkaufte Benefizien der Kirche in skandalöser Offenheit an den Höchstbietenden. Reiche Fürsten oder Edelleute konnten bis zu zehn oder zwölf Benefizien auf einmal erwerben. Klemens VII. erpreßte »freiwillige« Kredite und Hilfszahlungen und erhöhte die kirchlichen Steuern, bis selbst seine Bischöfe sich 1392 zu zahlen weigerten und ihren Protest an die Türen des päpstlichen Palastes in Avignon nagelten. Abhängig von Frankreich, überschrieb Klemens einen Anteil der Zehnten an die französische Krone und ergriff in den vielen Disputen, die daraus erwuchsen, Partei für die Krone gegen die Geistlichkeit. Keine Maßnahme konnte seine Gier je befriedigen; er mußte Geld von Wucherern leihen und die heiligen Schätze verpfänden. Als er starb, so sagte man, war selbst die päpstliche Tiara gepfändet.
Im Kaiserreich zeigte das Schisma deshalb weniger Wirkung,
weil die Verhältnisse bereits so chaotisch waren, daß eine Verschlechterung kaum denkbar war. Kaiser Karl IV. hatte vorsichtshalber noch vor seinem Tod seinen ältesten Sohn Wenzel als König von Böhmen krönen und vor der Zeit zum Kaiser erklären lassen, aber Eintracht und Einheit waren durch diese Titel nicht zu erzwingen. Das war kaum überraschend, da Kaiser Karl die Herrschaft über die kaiserlichen Territorien unter Wenzels beiden Brüdern, einen Onkel und einen Vetter aufgeteilt hatte. Deren Interessen standen häufig gegeneinander, die rivalisierenden Häuser von
Weitere Kostenlose Bücher