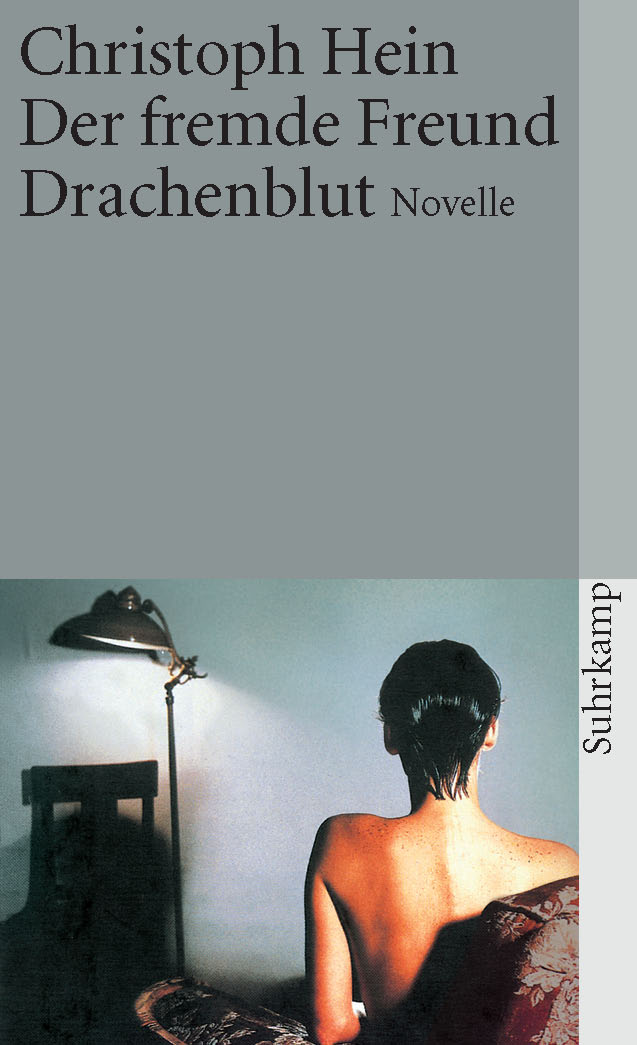![Der fremde Freund - Drachenblut]()
Der fremde Freund - Drachenblut
Strand. Es war kühl und windig. Die einzige Geschäftsstraße des Dorfes war belebt. Vor uns liefen Urlauber, verpackt in leuchtende, wetterfeste Kleidung. Auch auf der anderen Straßenseite liefen Urlauber mit der gleichen gelben Regenkleidung. Uniformen, wie die Anstaltskleidung von Heiminsassen.
Henry fragte, wer Fred und Maria seien, ob sie Freunde von mir wären. Ich erzählte ihm, daß ich sie seit ein paar Jahren kenne und selten sehe. Ob es Freunde seien, könnte ich nicht sagen.
Wir liefen dicht am Wasser entlang. Die Wellen hatten eine breite, grauweiße Schaumgrenze zum Land angeschwemmt. Der Wind war kräftig, ich empfand ihn als angenehm. Am Strand sahen wir nur wenige Leute, ein paar Spaziergänger. Die Strandkörbe standen dicht nebeneinander, sie waren verlassen und abgeschlossen.
Wir sprachen über Freunde, und ich sagte, ich wüßte nicht genau, ob ich Freunde habe. Als kleines Mädchen hatte ich eine Freundin, damals, in der Kleinstadt, in der ich aufwuchs. Ich trug Zöpfe und schwor einem anderen kleinen Mädchen, daß wir auf ewig Freundinnen seien, und damals waren wir es wohl auch. Aber das sei lange her,sagte ich, und wäre wohl auch alles kindlich und unerfahren gewesen. Heute könnte ich nicht einmal sagen, was das sei, ein Freund. Möglicherweise sei ich nicht mehr bereit oder fähig, mich einem anderen Menschen anzuvertrauen, was doch eine Voraussetzung dieser eigentümlichen Sache Freundschaft wäre. Wahrscheinlich brauche ich keine Freunde. Ich habe Bekannte, gute Bekannte, ich sehe sie gelegentlich und freue mich dann. Eigentlich aber wären sie austauschbar, also nicht zwingend notwendig für mich. Ich bin gern mit Menschen zusammen, viele interessieren mich, und es ist mir angenehm, mit ihnen zu reden. Aber das sei auch alles. Manchmal habe ich ein unbestimmtes Bedürfnis nach etwas wie einem Freund, einer kleinen, blassen Schulfreundin, aber das sei selten und mehr so wie die Tränen, die ich wider Willen im Kino weine bei irgendeinem Rührstück. Wirklich traurig sei ich da ja nicht. Ja, so ist das, sagte ich.
Henry hatte mir zugehört, ohne mich zu unterbrechen. Wir liefen jetzt schweigend den Strand entlang, der schmutzig und verwahrlost wirkte. Es waren keine Spaziergänger und keine Strandkörbe mehr zu sehen. Mein Gesicht brannte vom Wind und den kleinen Sandkörnern. Die Schuhe hatten wir ausgezogen. Es war kalt, aber so lief es sich besser.
Henry fragte mich, wie das damals gewesen wäre. Ich fragte ihn, was er meine, und er sagte: Damals, in dieser Kleinstadt. Ich sagte, daß ich nur unbestimmte Erinnerungen hätte und nicht sicher wäre, wie weit sie durch die Jahre verfälscht seien.
Ich glaube, sagte ich, ich war damals anders.
Sicherlich hatte ich Hoffnungen und gewiß so etwas wie Absichten und genaue Vorstellungen über das Leben. Aber Angst hatte ich auch damals schon. Und vielleicht war ich nie eine andere gewesen, und es war damals nur der Anfang von allem.
Henry sagte nichts. Wir liefen immer weiter am Strand. Wir sammelten Muscheln, und Henry fragte, ob ich mit ihm schwimmen wolle. Ich lehnte ab, es war mir zu kalt. Henry zog sich rasch aus und rannte gegen die Wellen ins Wasser. Mit einem Kopfsprung tauchte er unter. Er schwamm hastig und mit unregelmäßigen Bewegungen. Er schrie mir etwas zu, aber ich konnte ihn nicht verstehen. Als er aus dem Wasser kam, zitterte er. Ich frottierte ihn kräftig mit meinem Pullover ab, und wir lachten über sein Geschlechtsteil, das vor Kälte zusammengeschrumpft war. Dann rannten wir zurück und kamen atemlos und keuchend bei Maria an.
Am Abend erschienen Freunde von Fred, die in der Nähe Urlaub machten. Man gab sich ungezwungen, es wurden Witze erzählt und viel Wein und Schnaps getrunken. Maria blieb den Abend über einsilbig, was keinem auffiel. Henry und ich wollten früh ins Bett. Der lange Strandspaziergang hatte uns ermüdet. Als wir in unser Zimmer gehen wollten, hielt uns Fred zurück. Er sagte, er gebe die Gesellschaft für uns. Er redete auf uns ein. Schließlich blieben wir.
Ein Maler, der mit einem ungewöhnlich schönen Mädchen gekommen war, sprach über Kunst.
Wir sind nur noch Voyeure, sagte er, und nur wenn wir Voyeure sind, sind wir Künstler. Alle andere Kunst ist tot, vorbei, bürgerliche Scheiße. Das einzig lohnende Objekt der Kunst ist das Asoziale, der Randmensch. Jahrhundertelang ging es um Ansichten und Probleme der Kleinbürger. Verlogene Tafelmusik, die Parasiten zur Verdauung ihrer
Weitere Kostenlose Bücher