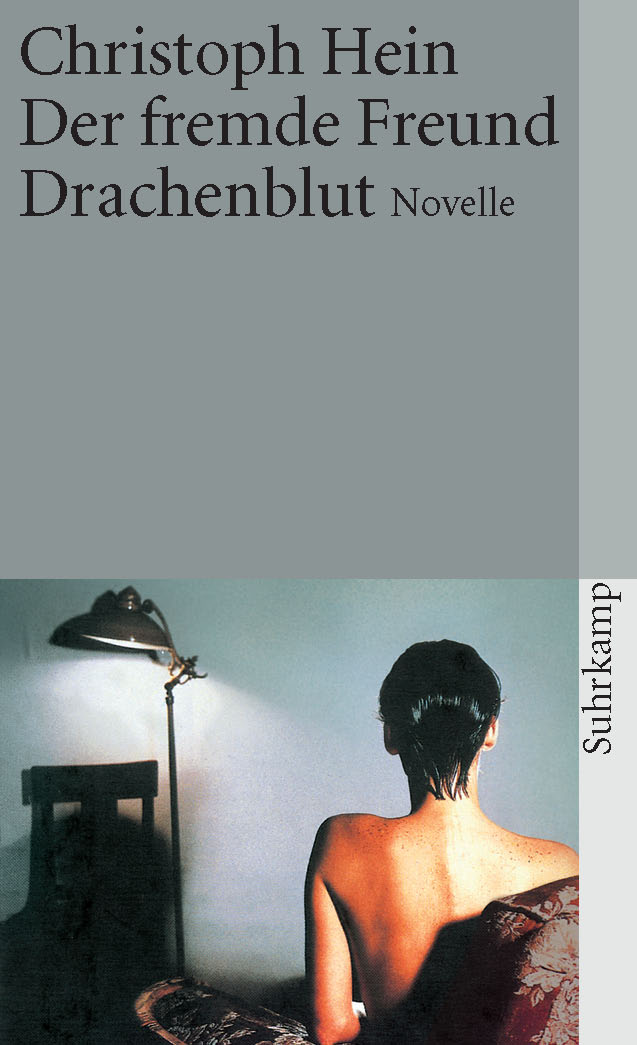![Der fremde Freund - Drachenblut]()
Der fremde Freund - Drachenblut
jeden Morgen ein Büschel Haare aus.
Das ist normal, sagte ich.
Sie schüttelte den Kopf: So viel ist nicht normal, du mußt mich nicht anlügen.
Red dir nichts ein. Du machst dich verrückt. Es ist völlig normal. Jeder Mensch verliert jeden Tag ein Büschel Haare. Und dein Gesicht ist in Ordnung. Du warst immer blaß. Und das steht dir, das weißt du doch.
Das sagt Fred auch.
Was sagt Fred auch?
Daß ich verrückt bin.
Ich wurde wütend. Sie saß vor mir, hatte die Augen geschlossen und litt offensichtlich. Aber warum mußte sie so etwas zu mir sagen. Warum sind diese sensiblen Seelchen so überaus unsensibel, sobald es nicht sie selbst betrifft.
Hör mal, du weißt genau, daß ich es nicht so gemeint habe. Warum zum Teufel unterstellst du mir ...
Sie hörte mir nicht zu. Sie zog geistesabwesend an ihrer Zigarette und schrieb mit dem Finger auf der Wachstuchdecke.
Warum trennst du dich nicht von Fred? fragte ich. Vielleicht ist das dein Problem.
Das geht dich nichts an, sagte sie und fuhr fort, unsichtbareSchleifen auf die Tischdecke zu malen. Ich trocknete weiter ab und räumte die Gläser ein.
Unvermittelt sagte Maria: Es liegt tiefer, viel tiefer. Irgendwann damals.
Ich hatte das Bedürfnis, sie zu berühren, und streichelte ihr Gesicht. Sie küßte leicht meine Hand und lehnte sich an meinen Arm. Und dann steckten wir die Köpfe zusammen und kicherten wie zwei kleine Mädchen.
Maria sagte, sie wäre müde und wolle ins Bett gehen. Ich ging wieder ins Zimmer. Henry saß noch immer mit Horst vor dem Kamin. Ich stellte mich hinter ihn und flüsterte ihm ins Ohr, ob wir nicht verschwinden sollten. Henry nickte erleichtert. Der Professor aus Bochum sprach über die Immanenzkritik der »Ökofreaks«. Ich fragte Henry, was das sei, aber er wußte es auch nicht. Er hätte ihm nur zugehört, verstanden hätte er nichts. Horst schien betroffen zu sein. Er versuchte es uns zu erklären, gab es aber bald auf, da wir nicht interessiert waren. Übergangslos sprach er dann von Sprachverschluderung und Amerikanismen. Er konnte offenbar über alles reden. Auf mich wirkte er wie eine Comicfigur, die beständig kleine runde Blasen vollspricht und sie dann irgendwohin segeln läßt.
Henry sagte, Horst rede, um nicht einen Augenblick mit sich allein sein zu müssen.
Der Westdeutsche lachte nervös. Dann meinte er, hier sei alles wie im 19. Jahrhundert, wundervoll intakt wie ein vergessenes Dorf. Ein Land, als habe es sich Adalbert Stifter ausgedacht. Ich sagte, daß ich noch nie etwas von Stifter gelesen habe.
Du mußt ihn nicht lesen, meinte Horst, du lebst ihn ja.
Wir verabschiedeten uns. Horst sagte wieder, wie gut er uns verstehen könne und daß es schön wäre, wenn wir uns nochmals treffen könnten. Wir sagten beide, daß wir es auch schön fänden, und gingen. Er strahlte noch immerüberzeugend sein Lächeln aus. Ich glaube, er war sehr allein.
Im Vorraum standen einige Gäste und schossen mit einem Luftgewehr auf brennende Kerzen, die vor der Toilettentür auf einem Hocker standen. Einige Bleikugeln steckten im lackierten Holz der Tür, und die kleine geriffelte Glasscheibe hatte von den Einschüssen spinnennetzartige Risse bekommen. In der Toilette jammerte eine Frauenstimme, man möge sie herauslassen, was die anderen belustigte.
Fred und der Maler saßen auf dem Sofa, zwischen ihnen das schöne Mädchen. Fred hatte sein Gesicht an ihren Hals gelegt und streichelte ihre Brüste, und der Maler weinte vor sich hin und wiederholte klagend, daß er die Kunst verraten habe, daß er sich selbst verraten habe. Dabei schlug er theatralisch die Hände zusammen.
Als wir an ihnen vorbeigingen, nickte uns das Mädchen zu. Noch vor unserem Zimmer hörten wir den Maler sich anklagen, daß er ein Verräter sei.
Als wir aufwachten, war es fast Mittag. Im Haus war es still. Die Sonne stand hoch an einem glasklaren, eisigblauen Himmel. Der Wind hatte sich gelegt. Durch das Fenster hörten wir Kinderstimmen. Henry schlug vor, baden zu gehen. Ich zog mein Nachthemd an und ging hinunter, um uns Bademäntel zu holen.
Maria war bereits auf und las. Das schöne Mädchen von gestern abend hantierte in der Küche. Sie hatte auf dem Sofa geschlafen. Maria gab mir die Bademäntel und zeigte mir einen abkürzenden Weg zum Meer.
Am Strand war es voll. Wir liefen lange, bis wir eine ruhigere Stelle fanden. Das Wasser war kalt, und wir schwammen anfangs schnell und atemlos. Die Kälte brannte auf der Haut. Henry wollte bald
Weitere Kostenlose Bücher