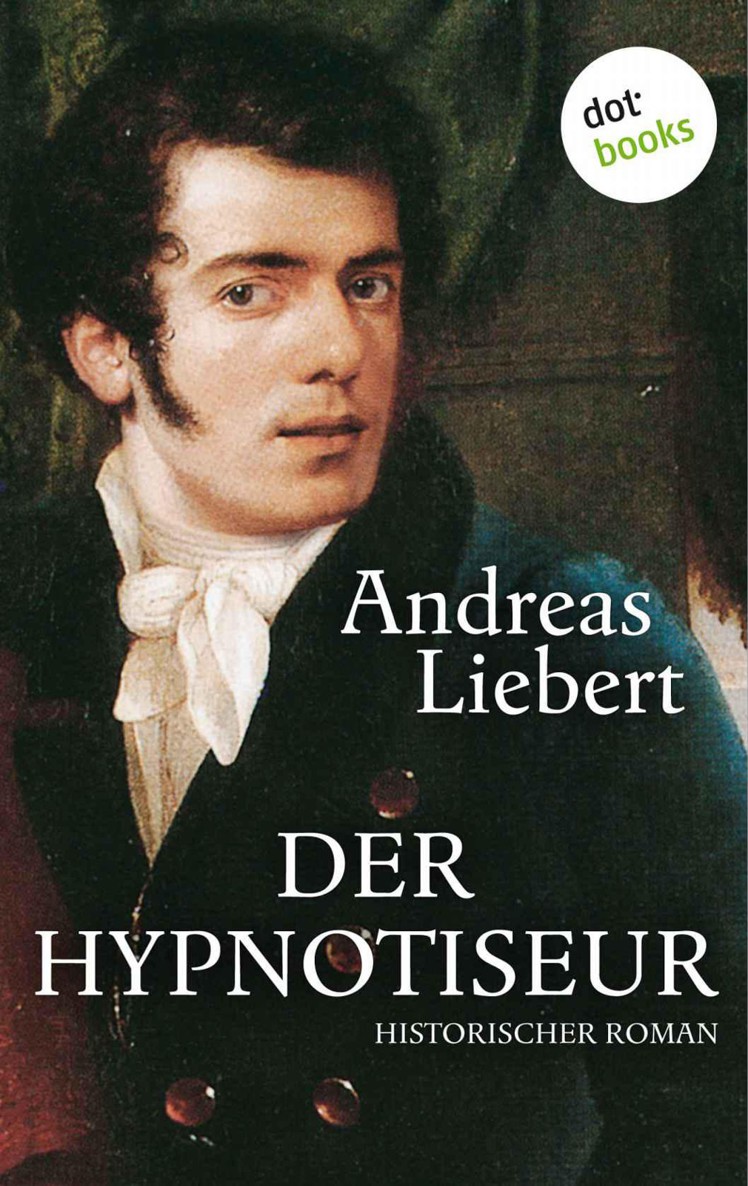![Der Hypnotiseur: Historischer Roman (German Edition)]()
Der Hypnotiseur: Historischer Roman (German Edition)
mundgerecht zuschneiden, mal ein Stück Brot nur mit Butter reichen, dann wieder eins mit einer Olive und einem Stück Kaninchenfleisch, ein andermal eine aufgeschnittene Trüffel auf einem Löffel Entenleberpastete.
So zog sich der Abend hin, bis ich schließlich in der Laune war, von der Ordensgesellschaft vom Heiligen Herzen Jesu zu erzählen, jener freien Ordensgesellschaft in Amiens, in deren Obhut ich gegen Ende des Jahres 1802 gegeben worden war:
»Ich weiß aus den wenigen Unterhaltungen mit der Mutter Oberin, dass mein Onkel in bestem Gewissen gehandelt hat. Aber was heisst schon mein Onkel! Jener Abbé de Villers ist der Freund eines nidwaldischen Priesters, der bei den Schweizer Aufständen 1798 ums Leben kam. Er nahm sich dessen gerade geborenen Kindes an, einer damals noch sehenden Marie-Thérèse. Die ersten Jahre, erfuhr ich, sei ich auf dem neuen elsässischen Gut der de Villers aufgewachsen. Sie sollen dort Tabak angebaut haben. Erst als die Mutter meines Onkels starb und er alles verkaufte, kam ich nach Amiens. Ich war damals vier Jahre alt, Erinnerungen ans Gut habe ich keine mehr. Nur ein paar sehr blasse Bilder, aus denen ich schließe, dass mein Augenleiden in Amiens begonnen haben muss.«
Petrus war überrascht: Er habe selbst einmal in Amiens gearbeitet: »Ostern 1816. Ein halbes Jahr lang durfte ich im Hospital Kriegsinvaliden pflegen. Und ja, dort gibt es das Mädchenpensionat der Madeleine Sophie Barat! Deren Zögling warst du? Aber ich habe nie etwas von einem Wunderkind gehört?«
»Weil es damals noch keines gab. Kurz vor Weihnachten 1815 erlöste mich mein Onkel von dieser bigotten Gemeinschaft, wobei Oberin Barat ihm immerhin gestand, ich hätte ein besonderes Talent für das Klavierspiel. So kam ich nach Wien, wo mich zunächst Ferdinand Ries und darauf Carl Czerny unterrichteten. Beiden verdanke ich meine Beethoven-Begeisterung. Ich lernte den Meister übrigens auch persönlich kennen. 1816 im Salon der Streichers, einer Klavierbauer-Familie, und das andere Mal 1818 in einem Hauskonzert Carl Czernys, kurz vor meiner Abreise nach Strasbourg. Beethoven vorzuspielen habe ich mich trotz der Bitten Ries´ und Czernys geweigert. Der Meister aber stand mir bei. Er sagte: ‚Sie sind fast blind, ich fast taub. Wie ich auch reagierte, es würde Ihnen schaden: Applaudierte ich, würde es heißen: Wie soll er es beurteilen, wo er doch so gut wie taub ist? Applaudierte ich nicht, würden die Leute sagen: Selbstverständlich! Wie soll eine, die Noten lesen muss, die groß sind wie Stiefel, auch Klavier spielen können? Trotzdem Marie-Thérèse: Ich weiß, Sie sind eine große Künstlerin. Zum einen, weil ein Ries und ein Czerny wollen, dass ich Sie höre und zum anderen, weil Sie genau dies nicht wollen. Da sind Sie mir ähnlich.’ Ich werde diese Worte nie vergessen. Wenn mir beim Üben die Kraft auszugehen droht, denke ich an sie und sie geben mir neuen Mut. Glaube ich hingegen, mit mir zufrieden sein zu dürfen, mahnen sie mich, demütig zu sein. Bis an mein Lebensende werde ich dem Meister dankbar für sie sein. Selbst mein Onkel lobt sie als vorbildlich. Überhaupt, was Beethoven betrifft, gehen wir d´accord. So eifersüchtig mein Onkel ist, Beethoven wäre der einzige, dem er ein solches kulinarisches tête à tête, wie wir es gerade pflegen, erlaubte.«
»Oh, dann habe ich ja Grund zur Eifersucht!« rief Petrus sarkastisch und entkorkte hastig die zweite Flasche Champagner. »Aber Beethoven ist ja wenigstens wer. Dein Onkel zwar auch, wenn auch tausendfach geringer und zehntausendfach hassenswerter.«
»Du willst andeuten, in seinen Augen Splitter gefunden zu haben?«
Nun war ich in der Laune, Ironie und Sarkasmus hervorzukehren. Petrus’ Larmoyanz brachte mich gegen ihn auf. Mein Lächeln muss äußerst geringschätzig ausgefallen sein, aber wahrscheinlich hatte er schon so viel Champagner intus, dass er es nicht mehr bemerkte. Nun – ich hielt ihm mein Glas hin, ohne die Augen von ihm zu nehmen. Was ihn auch immer bewog, meinen Onkel dermaßen zu hassen, Petrus hatte nicht dreizehn lange Jahre im Baratschen Pensionat zubringen müssen! Die Jahre der Demütigungen dort kann ich genauso wenig vergessen wie die Worte Beethovens. Dabei hatte ich gegen Mère Barat an sich wenig einzuwenden. Sie, die ständig reiste, liebte ihre Zöglinge aufrichtig, war sanft und hatte ein offenes Ohr für kleine Wünsche. Andererseits war sie auch eine extreme Frau: „Wir lernen um Jesu willen
Weitere Kostenlose Bücher